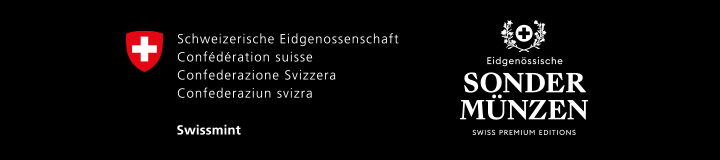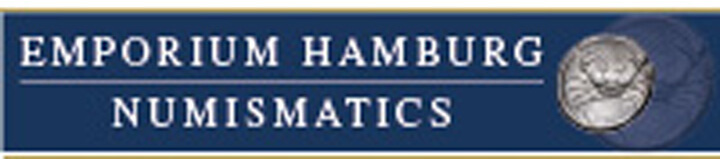Louvre, Manching, Berlin: Verändern diese Raubzüge die Kulturgüterschutzdebatte?
Es ist eine schreckliche Vorstellung: Unersetzliche Kulturgüter werden zerstört, um ihre Bestandteile zu verkaufen. Dies führt uns vor Augen, dass Kulturgut nicht nur einen historischen, sondern auch einen Materialwert hat. Könnte diese Erkenntnis die Kulturgüterschutzdebatte verändern?
von Ursula Kampmann
Inhalt
Ein Muster ist entstanden. Räuber brechen gewaltsam in Museen ein, rauben Kulturgut aus Gold und Edelstein, zerstören es, um an die wertvollen Rohstoffe zu kommen, und verkaufen sie – relativ gefahrlos – an den nächsten Juwelier, den nächsten Goldhändler. Es ist ein altes Muster, das wir fast schon vergessen hatten.
Ein schrecklicher Münzraub im Jahr 1831
Denn genau so gingen bereits die Einbrecher vor, die in der Nacht vom 5. auf den 6. November 1831 das Pariser Cabinet des Médailles ausraubten. Sie stahlen Exponate aus Gold und Silber im Gewicht von 80 Kilogramm(!), darunter den „Schatz des Childerich“ mit dem königlichen Siegelring. Dazu erbeuteten sie Schmuck und etwa 2.000 Goldmünzen mit zahlreichen Unika sowie römischen Aurei, Solidi und Multipla.
Vidocq, legendärer Chef der Pariser Sureté, schloss aus der Methode auf die Beteiligten. Es gelang ihm, sie zu identifizieren. Tatsächlich wurden alle Diebe überführt, das gesamte Kulturgut sichergestellt. In Form von 75 Gold- und Silberbarren. Nur ein winziger Teil der Kostbarkeiten entging der Schmelze.
Der schrecklich Münzraub von Manching
Kommt Ihnen die Geschichte bekannt vor? Genau dasselbe ist mit den keltischen Münzen von Manching geschehen. Es ist mit der kanadischen 100 Kilogramm Goldmünze passiert, die per Schubkarren aus dem Bode-Museum abtransportiert wurde. Das gleiche Schicksal hätte den aus dem Louvre gestohlenen Juwelen gedroht, hätte die Politik nicht die Suche nach den Verbrechern zur Chefsache gemacht. Das gewaltige Aufgebot an Polizei wird hoffentlich das Schlimmste verhindern. Aber sind wir uns ehrlich: Hätte es sich nicht um den Louvre gehandelt, wären die Objekte nicht mit bekannten Namen wie Napoleon und Kaiserin Eugénie verbunden, wäre die Sache im Sande verlaufen. Wir werden ja sehen, ob die in Langres gestohlenen Münzen jemals wieder auftauchen!
Münzen bestehen aus Edelmetall
Und das führt uns an die Wurzel des Problems: Münzen bestehen meist aus Gold und Silber. Sie einzuschmelzen ist ein Kinderspiel. Die notwendigen Werkzeuge lassen sich im Internet bestellen, und eingeschmolzen sieht kein Juwelier, aus welchem Gold ein Barren besteht.
Münzen haben immer schon aus Gold und Silber bestanden. Bevor es Sammler und Münzhändler gab, brachte man sie zum Schmelzen in die Münzstätte oder zum Goldschmied. Und zwar ganz gleich, ob es sich um einen Aureus des Pertinax in FDC handelte oder um einen abgelutschten Aureus des Nero. Schließlich bestehen beide Stücke aus guten 7 Gramm Gold. Und Gold war und ist wertvoll.
Nicht der Kunstmarkt ist das Problem, sondern die Gesellschaft
Und damit illustrieren all die Raubzüge der letzten Jahre eine Tatsache, die von Sammlern in der Kulturgutschutzdebatte immer wieder vorgebracht wurde. Allerdings wollte kein Politiker dieses Argument hören: Das Ende des Kunstmarkts führt nicht zum Ende der Raubgräberei. Es wird nur dafür sorgen, dass Münzen wieder in den Schmelztiegeln lokaler Goldschmiede landen, wie sie es noch in den 1950er und 1960er Jahren regelmäßig taten.
Münzhändler wie Pierre Strauss haben Hunderte von seleukidischen Münzen gerettet, indem sie regelmäßig die Basare von Damaskus oder Aleppo besuchten, wo sie numismatische Schätze aus der Schmelzware klaubten.
Denn es gibt in Syrien, Afghanistan und wahrscheinlich auch in Sizilien Menschen, die weder Arbeit noch Hoffnung haben, denen es gleichgültig ist, was mit einem Kulturgut geschieht, solange es ihnen die überlebenswichtige Mahlzeit sichert.
Wollen Sie es diesen Menschen verdenken, dass sie nach alten Münzen suchen, die sie dann für einen Bruchteil ihres Wertes an einen lokalen Händler verschachern?
Der Kunstmarkt als gute Ausrede, nichts zu tun
Länder, denen ihre Kulturschätze am Herzen liegen, müssen diese vor Ort sichern. Aber dazu fehlt der politische Wille. Das nationale Erbe zu bewahren, kostet Geld, Arbeit und Mühe. Die investieren Politiker lieber in prestigeträchtigere Projekte. Und nein, das ist kein Seitenhieb auf das große, neue Museum am Fuße der Pyramiden. (Na ja, vielleicht ein kleiner.) Es ist das Versagen der Regierungen, das zur Plünderung ihres nationalen Kulturguts führt. Den Kunstmarkt zu beschuldigen, er sei dafür verantwortlich, ist eine billige Ausrede, die so lange und mit so viel Autorität wiederholt wurde, bis die Medien und damit die Öffentlichkeit sie glaubte.
Es ist tragisch, dass unsere archäologischen Institute weltweit auf das Wohlwollen eben dieser Regierungen angewiesen sind. Sie brauchen ihre Grabungsgenehmigungen, wollen sie ihre Raison d’être nicht verlieren. So machten sich wissenschaftliche Leuchttürme wie das DAI zum Erfüllungsgehilfen ausländischer Regierungen und verbreiteten die Mär, dass allein der Kunstmarkt am Ausverkauf ausländischen Kulturguts schuld sei.
Nein, Sammler wollen keine Raubgrabungen!
Verstehen Sie mich richtig: Ich will die Verhältnisse der 1950er und 1960er Jahre sicher nicht zurück. Ich möchte, dass Raubgrabungen aufhören, genauso wie die meisten anderen Sammler. Ich möchte mit meinen beschränkten Mitteln dabei helfen. Aber ich möchte auch eine Debatte auf Augenhöhe, in der wir alle darüber sprechen, wie wir Kulturgut besser schützen. In dieser Debatte darf niemand am Pranger stehen. Stattdessen sollten wir gleichberechtigt und offen über Probleme und Lösungsansätze diskutieren.
Erziehung als ein Schlüssel
Ja, natürlich muss viel Geld investiert werden, um Kulturgüter besser zu sichern. Aber auch andere Maßnahmen muss man diskutieren. In meinen Augen ist die Erziehung zentral, wenn es gilt, Kulturgut zu bewahren. Wem die Kelten wurscht sind, wer nichts mit Napoleon verbindet, der hat keine Hemmschwelle, ihre Reliquien zu zerstören. Es ist bezeichnend, mit welch süffisantem Lächeln hochgebildete Numismatiker das Einschmelzen der kanadischen 100 Kilogramm-Goldmünze kommentierten. Für sie war das kein Zeugnis unserer Geschichte, sondern lediglich „so eine moderne Münze“. In ihren Augen war der Schmelztiegel dafür genau der richtige Platz. Keiner von ihnen überlegte sich, welch technische Meisterleistung hinter ihrer Produktion stand. Von der historischen Bedeutung für die Geschichte des Goldhandels mal ganz abgesehen. Die Betroffenheit, als von den keltischen Stateren Manchings nur ein paar Barren blieben, war eine ganz andere.
Wenn wir bei uns unter Numismatikern schon diskutieren, was wichtiges Kulturgut ist und was weg kann, wie mag es dann in anderen Ländern sein? Wir wird es bei uns sein, wenn der Geschichtsunterricht noch weiter zurückgefahren wird, die Museen hauptsächlich politische Botschaften verbreiten und die Faszination des Objekts mehr und mehr schwindet?
Profit als Lösung
Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Lösung des Problems im Gewinnstreben des Menschen liegt. Eine faire Belohnung gibt dem, der eine Münze findet, einen Grund, mit den verantwortlichen Archäologen zusammenzuarbeiten. Ja, hier kommt das britische Portable Antiquity Scheme ins Spiel, dem es hervorragend gelingt, Öffentlichkeit und wissenschaftliche Welt zu verbinden.
Es kommen aber auch Erfahrungen aus dem afrikanischen Tourismus ins Spiel. Wer als Ranger ein sicheres Gehalt bezieht, weil er Touristen durch einen Wildpark führt, hat ein anderes Verhältnis zu Wilderern. Beteiligung der lokalen Bevölkerung ist ein Erfolgsrezept. Wer von einem Kulturgut profitiert, wird zu einem Multiplikator und zu einem Botschafter der Sache.
Ich weiß, das alles sind steile und vor allem unbequeme Thesen. Archäologen und Politiker müssten ihr Feindbild und ihr eigenes Verhalten überdenken. Das ist anstrengend und tut weh. Aber am Ende stünde eine bessere Zukunft, in der wir zusammen und nicht gegeneinander arbeiten, um Kulturgut zu erhalten.