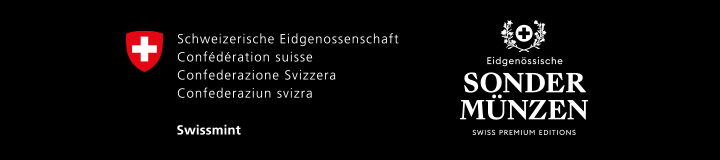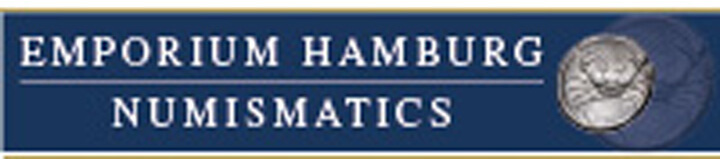Zwischen Tradition und den Anforderungen einer neuen Wirtschaftswelt
Als ich endlich nach fast einer Woche numismatisch-historisch-zoologischer Exkursionen in Kapstadt landete, um an der Mint Directors Conference teilzunehmen, hatte ich fast vergessen, dass ich eigentlich nur deswegen nach Südafrika gefahren war. Aber sobald die ersten wohlbekannten Gesichter auftauchten, war ich wieder zurück, mitten drin in der Welt der Münzen.
Die Konferenz begann am Sonntag Abend, dem 27. April 2025, mit einem großen Empfang in Kapstadts Ausgehmeile und endete nach zwei übervollen Tagen mit Vorträgen, Workshops, Round Tables und informellem Austausch am Dienstag, dem 29. April 2025 mit einem eindrucksvollen Gala-Dinner. 230 Delegierte aus 31 Nationen von 93 Organisationen reisten zu diesem Großevent an. Das waren nicht ganz so viele wie bei vorherigen MDCs. Hier machten sich die extrem hohen Flugpreise nach Südafrika bemerkbar, die so manchen Firmenchef zum Grübeln brachten, ob er wirklich so viele Personen nach Südafrika schicken sollte wie sonst.
Inhalt
Ein vielseitiges Programm
Traditionell ist die MDC alle zwei Jahre der Anlass, die Ergebnisse vorzustellen, die die verschiedenen Sub-Komitees erarbeitet haben. Es gibt also viele Updates zu technischen Handbüchern und Best Practise. Aber das sind nicht die einzigen Themen, mit denen der technische Bereich punktet.
Ging es in der Vergangenheit um Geschwindigkeit, Effizienz und Kostenreduktion, verlagert sich das Gespräch seit einigen Jahren immer mehr auf die Nachhaltigkeit. Die Reduktion des CO2-Fußabdrucks einer Münze mag den Sammler nicht interessieren, für die Münzstätten ist sie dagegen elementar. Schließlich sind die meisten von ihnen immer noch eng mit staatlichen Stellen verbunden. Und kein Finanzminister möchte im Exklusivbericht eines Investigativ-Journalisten lesen, dass seine Münzstätte zu den Umweltsündern zählt.
Ein weiteres zentrales Thema der Veranstaltung war KI, bei der sich viele Münzstättenleiter fragen, wie man sie in den Produktionsalltag integrieren kann. Das Problem dürfte in vielen Fällen der Kostenfaktor sein. Deswegen sind es vor allem große Münzstätten, die KI-Projekte implementieren, die eine enorme Steigerung der Effizienz bringen (können). Die Betonung liegt auf können. Das bedeutet zunächst immense Investitionen, um sinnvoll von unsinnig abzugrenzen. Es bleibt zu sehen, in wie weit die großen Münzstätten bereit sein werden, ihre Erkenntnisse mit den kleineren zu teilen, die sich so die aufwändigen Fehlschläge sparen könnten.
Schwindende Benutzung des Bargelds in Industrieländern
Das zentrale Thema für alle Münzstätten ist seit mehr als einem Jahrzehnt die schwindende Akzeptanz von Bargeld. Dieses Phänomen ist in praktisch allen westlichen Industrieländern zu beobachten. In den vergangenen Jahren hörten wir trotzdem viele Vorträge, die von steigenden Prägezahlen berichteten. Dieses Paradoxon wurde zum großen Teil durch ein nicht angepasstes Münzportfolio verursacht. Nachdem inzwischen immer mehr Länder die Nominale abschaffen, die nach wenigen Transaktionen im Nirwana verschwinden, sind die Themen andere. Nun geht es darum, wie man mit dem Bürger zusammenarbeiten kann, um das Bargeld zu erhalten.
Die Royal Canadian Mint führte zum Beispiel eine Untersuchung durch, in der sie feststellte, dass sich immer noch 85% der Kanadier mit Bargeld identifizieren und 74% nicht den Wunsch haben, das Bargeld aufzugeben. Die Monnaie de Paris illustrierte, dass Bargeld immer noch die zweitwichtigste Zahlungsmethode darstellt.
Das Problem ist, diesen Wünschen der Bevölkerung das Gehör der Zentralbanken und Politik zu verschaffen, um sich gegenüber der Lobby von Banken und Finanzdienstleistern Gehör zu verschaffen. Um dafür eine bessere Zusammenarbeit zu schaffen, wurde ein Workshop durchgeführt.
Die südafrikanische Perspektive: Bargeld wird gebraucht
Zum Nachdenken regte der südafrikanische Beitrag dieser Session an. Er sprach von der zentralen Wichtigkeit des Bargelds gerade für die ärmere Bevölkerung. In Südafrika gibt es einen großen informellen Sektor. Darunter versteht man den Teil der Wirtschaft, in den sich der Staat nicht mittels Steuern und Regelungen einmischt. Dieser Sektor ist besonders wichtig für die verletzlichen Teile der Bevölkerung, also für Arbeitslose, Emigranten, Ungelernte. Sie können so arbeiten, ohne vorher den Papierkram zu erledigen, für den ihnen sowieso die Unterlagen fehlen. Natürlich sind die am informellen Sektor Beteiligten nicht durch Gesetze geschützt. Aber wer keine Wahl hat…
In westlichen Gesellschaften wird versucht, diesen Sektor (wir nennen ihn Schwarzarbeit) zu unterdrücken. In Südafrika füllt der informelle Sektor pragmatisch und effizient Lücken, mit denen sich der Staat nicht belastet.
Der informelle Sektor lebt von Kleinstbeträgen. Ein gutes Beispiel ist der öffentliche Nahverkehr, den in Südafrika private VW-Busse übernehmen. Mit diesen Bussen gelangen diejenigen, die sich kein Auto leisten können, von Punkt A nach Punkt B. Eine staatliche Alternative gibt es nicht. Und weil Millionen von Südafrikanern täglich mit diesen Bussen zur Arbeit / zum Einkaufen / zur Schule / zur Familie fahren, brauchen sie allein dafür Millionen von 1 Rand-Münzen der South African Mint, um das Ticket bar zu bezahlen.
Für mich war dieser Vortrag das Highlight. Denn er illustrierte, welches Luxusproblem der Rückgang des Bargeldes eigentlich ist. In Gesellschaften, in denen die Mehrheit kein Bankkonto und keine Kreditkarte erhält, weil der Dienstleister an ihnen nichts verdient, ist Bargeld zentral. Mit anderen Worten: Der Rückgang des Bargelds ist ein Symptom unseres Wohlstands. Wer ihn in einem Industrieland nicht teilt, fällt durchs Raster. Und da diese Menschen keine Stimme haben, geht ihr Bedarf an Münzen und Scheinen unter im lauten Werben der Banken für immer neuere digitale Zahlungsmethoden.
Der Elefant im Raum
Viele Münzstätten der Industrieländer, deren Angestellte mit der Herstellung von Umlaufmünzen nicht mehr ausgelastet sind, haben Gedenkmünzen als neues Business Modell entdeckt. Die Folge: der Markt wird von staatlichen Gedenkmünzen geradezu überschwemmt. Interessanterweise fand dieses Thema keinen Niederschlag während der Konferenz. Der Grund: das Komitee, das sich früher mit Gedenkmünzen beschäftigte, existiert nicht mehr. Ein großes Manko, das einen blinden Fleck erzeugt und von mehreren Besuchern thematisiert wurde. Aktuell gibt es Bemühungen, das Komitee wieder zu beleben. Hoffentlich sind sie von Erfolg gekrönt.

Terry Hanlon, Präsident von Dillon Gage erklärt, wie in den Vereinigten Staaten Bullionmünzen vermarktet werden
Eine Alternative zu Gedenkmünzen sind Bullionmünzen, wie sie mittlerweile fast jede Münzstätte prägt. Nun ist Südafrika das Land, in dem die Bullionmünze erfunden wurde. Es war also gesetzt, dass hier ein Schwerpunkt des Programms lag und die Sprecher hochkarätig waren. Natürlich stand der Krügerrand im Mittelpunkt. Von der Rand Refinery über den Erfolg des Krügerrands bis hin zur zeitgemäßen Vermarktung von Bullionmünzen reichten die Themen.
Am eindrücklichsten war für mich der Beitrag von Terry Hanlon von Dillon Gage. Er illustrierte, wie viel Technologie, Knowhow und Geld sein Unternehmen investiert, um den kleinen Händler vor Ort nicht nur mit Bullionmünzen zu versorgen, sondern auch mit dem notwendigen Wissen, damit er dem Endkunden immer den korrekten Preis bieten kann (zuzüglich natürlich zur Gewinnspanne, die er für seine Tätigkeit kalkulieren muss).
Münzen sind antibakteriell
Wir alle erinnern uns, welchen Schub das digitale Zahlen während Corona erhielt. Viele Unternehmen nutzten damals das unsinnige Argument, Bargeld würde Bakterien übertragen, um dem Kunden eine teure – für das Unternehmen billigere – Zahlungsvariante aufzuschwatzen. Dass Münzen hygienischer sind als Kreditkarten, ist längst erwiesen. Poongsan treibt diese Forschung weiter. Die antibakteriellen Eigenschaften von Münzen sind mit den Kupferlegierungen verbunden. Die Frage ist nun, wie sie sich verändern, wenn das Kupfer mit preiswerteren Materialien kombiniert wird. Schließlich kann sich kein Land der Welt mehr Kleinmünzen aus echtem Kupfer leisten.
Gerade in den asiatischen Ländern, in denen oft riesige Menschenmengen auf engstem Raum zusammenleben, ist dies ein Thema, das heiß diskutiert wird, um für eine kommende Epidemie gewappnet zu sein.
Modernste Konferenztechnologie: Vorteile und Schattenseiten
Organisiert wurde die Konferenz von Reconnaissance International, dem erfolgreichsten Veranstalter von Konferenzen zu Themen des Zahlungsverkehrs und des Sicherheitsdrucks. Reconnaissance führt jeden Monat weltweit gleich mehrere Konferenzen durch. Modernste Konferenztechnologie ist für Reconnaissance also keine Frage, sondern eine Selbstverständlichkeit.
Ein Problem, das Reconnaissance mit seiner Technologie löst, ist die Zurückhaltung der Teilnehmer beim Stellen von Fragen. In der Vergangenheit beherrschten einige wenige Personen die Diskussion. Es ist schließlich nicht jedermanns Sache, vor mehreren Hundert Anwesenden aufzustehen und in einer Sprache, die meist nicht die Muttersprache ist, eine Frage zu formulieren. Das kann man jetzt über eine App tun. Das Resultat: viele Fragen, aus der jemand die Fragen auswählt, die dem Redner gestellt werden.
Die Kriterien, nach denen die Fragen ausgewählt wurden, blieben dem Publikum unklar. Viele beschwerten sich, dass kritische Fragen oder gar wichtige Korrekturen an den Aussagen der Sprecher so keine Chance hatten, aufs Tapet zu kommen.
Das System belebt zweifellos die Diskussion, macht sie gleichzeitig weniger kontrovers und damit nutzlos. Denn gerade das Aufeinanderprallen verschiedener Meinungen macht den Unterschied aus zwischen Konferenz und der Lektüre eines Artikels. So mutiert der Redner zum Prediger, dessen Autorität durch Fragen nicht erschüttert werden kann.
Gleichzeitig soll die App der besseren Vernetzung dienen. Das tut sie auch bei den Teilnehmern, die ihre Nachrichten regelmäßig checken. Das klappte schon während der Konferenz nicht so richtig. Nach der Konferenz? Keine Chance! Ich alter Dinosaurier sehne mich nach jeden wunderbaren bebilderten Programmen, in denen ich noch nach Jahren Namen und Adresse eines Konferenzteilnehmers nachschlagen kann, den ich kontaktieren möchte.