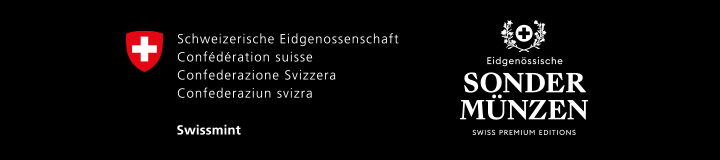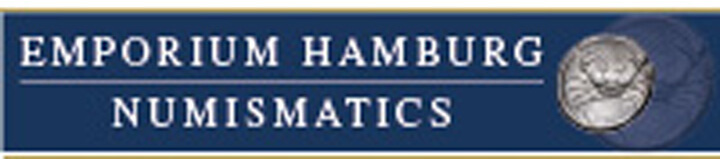Vom Sammler- zum Investorenmarkt: Ursachen, Konsequenzen, Chancen, Teil 1
von Ursula Kampmann
Klagen hilft nichts: der Wandel kommt oder ist sogar schon da. Die Frage ist, wie man mit ihm umgeht. Um kluge Strategien zu entwickeln, muss man sich bewusst sein, was eigentlich geschieht und warum. Ursula Kampmann fasst in einer losen Serie die wichtigsten Veränderungen zusammen. Heute: der Wandel vom Sammler zum Investorenmarkt.
Inhalt
Wer – wie ich – das Glück hatte, einige wirklich alte Sammlungen sehen zu dürfen, weiß, dass im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts selbst die finanzstärksten Sammler anders sammelten als wir das heute tun. In ihren Sammlungen finden sich Münzen in allen Erhaltungen, von „schön“ bis „Stempelglanz“ und das nebeneinander. Das liegt nicht etwa daran, dass die Sammler den Unterschied in der Erhaltung nicht erkannt hätten oder nicht zu schätzen wussten. Im Gegenteil, wir wissen aus Briefen, wie wichtig es ihnen war, nur besterhaltene Stücke zu kaufen. Diese Zusammensetzung von Sammlungen dürfte daher eher mit der begrenzten Auswahl zusammenhängen, die sich damals einem Sammler bot: Bis weit in die 1970er Jahre war für ihn nämlich der lokale Münzhändler seines Vertrauens die wichtigste Bezugsquelle. Das bedeutete, dass der Wohnort eines Sammlers der entscheidende Faktor war. Wer das Glück hatte, in London, Paris, Wien oder Frankfurt zu leben, konnte aus dem Vollen schöpfen. Wer dagegen in der Provinz residierte, verfügte nur über eine sehr begrenzte Auswahl, wenn er nicht selbst reiste oder sich eines vielreisenden Agenten bediente.
Als Anlageobjekt ungeeignet!
Solche Sammlungen waren ein kostbarer Besitz. Ein Investitionsobjekt waren sie nicht. Denn Teil jeder Investition ist es, dass sie sich im Bedarfsfall schnell zu Geld machen lässt. Das war vor den 1970er Jahren für Münzen nicht der Fall. Nur die wertvollsten Ensembles wurden als Auktionseinlieferungen akzeptiert. Meist kaufte ein Münzhändler die Sammlung vollständig an, um sie danach langsam zu vermarkten. Dabei wartete er oft Jahre lang, bis der richtige Käufer kam. Das musste er zwischenfinanzieren. Ein teures Unterfangen! Er machte trotzdem Gewinn, weil er die Münzen in der Regel weit unter dem gängigen Marktwert ankaufte. Verlierer war der Sammler, der an seiner Münzsammlung viel Geld verlor.
Die 1970er Jahre
Das ist heute anders. Heute haben Sammler eine gute Chance, beim Verkauf Gewinn zu machen. Denn Münzen sind zu einem beliebten Investitionsgut geworden. Die Wurzeln dieser Veränderung liegen in den 1970er Jahren.
Sie erinnern sich: In den späten 1960er Jahren kam der Dollar als weltweite Garantiewährung in Bedrängnis. Die militärischen Ambitionen der USA verschlangen Milliarden und die wurden einfach mit Hilfe der Notenpresse erzeugt. Das hatte Auswirkungen auf die garantierte Golddeckung des Dollars, denn das Verhältnis zwischen umlaufender Geldmenge und den in Fort Knox vorhandenen Goldreserven veränderte sich dramatisch. Die europäischen Regierungen waren nicht mehr bereit, diese Geldpolitik durch kostspielige Investitionen in einen günstigen Goldkurs mitzutragen. Erst stieg Frankreich aus, dann – 1968 – die anderen Europäer. Dies zwang den amerikanischen Präsidenten zu reagieren: Am 16. August 1971 verkündete Richard Nixon, dass die Goldpreisbindung des amerikanischen Dollars aufgehoben sei. Wir sprechen heute vom so genannten Nixon-Schock, der nicht nur zur Inflation führte, sondern auch den Goldpreis explodieren ließ: Am 31. Dezember 1975 kostete eine Unze Gold an der New Yorker Börse 148,80 $, am 21. Juli 1978 wurde die 200 $ Marke überschritten, ein knappes Jahr später die 300 $ Marke. Am 17. September 1979 erreichte der Preis 400 $, am 19. Dezember 1979 500 $. Im Januar 1980 ging der Preis endgültig durch die Decke: 607,80 $ am 3. Januar, 722,40 $ am 14. Januar, 854,80 $ am 18. Januar.
Nun gibt es eine alte Münzhändlerregel: Goldpreis und die Nachfrage nach Münzen verhalten sich proportional: Denn hinter beiden Phänomenen steckt die gleiche Angst, die Angst vor Unsicherheit und Inflation. Sie zwingt alle zu überlegen, wie sie ihre Ersparnisse in Sicherheit bringen können. Die einen kaufen Immobilien, die anderen Whiskey, Edelsteine oder Münzen.
Das Investitionsobjekt des kleinen Mannes
Münzen haben – genau wie Gold – gerade für die Käufer der Mittelschicht einen großen Vorteil: es gibt sie in allen Preislagen. Sie zu kaufen, ist praktisch mit jedem Einkommen möglich, während zum Beispiel eine Immobilie oft die finanziellen Möglichkeiten der kleinen Sparer übersteigt. Dazu ist ein Münzkauf relativ einfach zu bewerkstelligen. Man braucht kein umfangreiches Spezialwissen, kein Depot, keine Bank.
Denken wir noch daran, dass sich der Besitz von Münzen nicht von staatlicher Seite kontrollieren lässt, dass man sie auf jede Flucht mitnehmen kann, und dass Edelmetall überall in der Welt das Überleben sichert, dann verstehen wir, warum Anleger Münzen lieben.
Die Münze wird zum Anlageobjekt
Zum Anlageobjekt wurde die Münze in den 1970er Jahren. Damals begannen auch viele Menschen, die vorher keine Münzen gesammelt hatten, Münzen zu kaufen. Damit vervielfachte sich das Volumen des Münzmarkts. Das verursachte eine Zunahme der hauptberuflichen Münzhändler, darunter viele junge Quereinsteiger.
Von ihnen hatten die wenigsten das Geld, ein umfangreiches Lager anzulegen und große Sammlungen anzukaufen. Sie setzten auf Auktionen ohne Eigenware. Dadurch entstand eine Konkurrenzsituation zu Gunsten des Verkäufers. Er hatte jetzt die Möglichkeit, seine Münzen jederzeit zu verkaufen – entweder über eine Auktion oder im Direktverkauf, wobei er in beiden Fällen unterschiedliche Angebote prüfen konnte. Münzen bekamen so einen verhältnismäßig schnell realisierbaren Geldwert. Sammler konnten sich schon vor einem Verkauf über diesen Wert informieren. Denn viele Verlage produzierten Kataloge zu den verschiedenen Sammelgebieten mit Wertangaben für unterschiedliche Münztypen.
In diesen Jahren geschah aber noch etwas anderes: Münzen entwickelten sich zu einer Ware, deren Verkauf nach den Gesetzen der Marktwirtschaft organisiert wurde. Zielgruppenanalyse, Werbung, Kundenbindung und Kaufmotivation hielten Einzug in die PR-Abteilungen des Münzhandels. Natürlich nicht beim kleinen Münzhändler von nebenan, sondern bei einer ganz neuen Gruppe von Unternehmen: den Direct Marketing Agenturen.
Ihr Konzept bestand darin, den Münzkauf für den Kunden so einfach wie möglich zu machen. Münzen wurden im Abonnement vertrieben. Diese Abonnements schnitt man auf bestimmte Zielgruppen zu. Die potentiellen Kunden suchte man mittels Werbung, die eben nicht in den numismatischen Medien publiziert wurde, sondern in den Organen, die eine angepeilte Zielgruppe mit Vorliebe konsumierte. Das konnte eine Boulevardzeitung sein oder – später – ein Shoppingkanal im Fernsehen.
Dieses Vermarktungsmodell funktionierte und funktioniert nur dank immenser Investitionen in die Werbung. Deshalb verlangt es nach Münzen, die diesen Aufwand wert sind, also jederzeit in solch großen Quantitäten erworben werden können, dass es sich lohnt. Die zeitgenössischen Gedenkmünzen erwiesen sich als das optimale Produkt für diese Form des Münzhandels.
Weil die staatlichen Münzstätten nicht schnell genug ausreichende Mengen liefern konnten, füllten private Münzstätten die Lücke. Sie arbeiteten dafür mit den Finanzministerien von Staaten zusammen, die bereit waren, für eine Gebühr, ihr Prägerecht zur Verfügung zu stellen. Es entstand das, was wir heute als Non Circulating Legal Tender kennen. Die Bilder auf diesen Münzen sagen kaum etwas über das Land aus, in dessen Namen sie produziert wurden. Sie werden bestimmt davon, was sich auf den wichtigsten Sammlermärkten in Westeuropa und den USA am besten verkaufen ließ.
Dabei blieb das zentrale Verkaufsargument aller Direct Marketing Agenturen die potentielle Steigerung des Sammlerwerts eines angebotenen Objekts. Die Werbestrategen hatten verstanden, dass es am leichtesten ist, dem Kunden mittels seiner eigenen Gier das Geld aus der Tasche zu ziehen. Prägungen, bei denen ein Wertzuwachs sicher scheint, gehen noch heute weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln.
Auch wenn sich viele seriöse Münzhändler darum bemühten, ihren Kunden keine überzogenen Hoffnungen zu machen, gingen ihre Warnungen unter im lauten Chor der anderen Stimmen. Überall las man reißerische Geschichten von dramatischen Wertsteigerungen einer unauffälligen Münze. Niemand sprach die Tatsache aus, dass der Wert einer Münze – wie bei JEDEM Anlageobjekt – nicht nur steigen, sondern auch fallen kann.
Die große Enttäuschung
So überraschte es viele, als im März 1980 die geplatzte Silber-Spekulation der Hunt Brüder auch den Münzenmarkt mit ins Verderben riss. Plötzlich rieben sich viele Investoren die Augen und fragten sich: Was mache ich da? Die Nachfrage brach zusammen, die Neuausgaben der Münzstätten blieben liegen, und die Auktionatoren rauften sich wegen der vielen Retouren die Haare.
In den Folgejahren mussten zahlreiche Münzhandlungen schließen, allen voran diejenigen, die sich wie Numismatic Fine Arts in Los Angeles ausschließlich auf vermögende Investoren konzentriert hatten.
Aber im großen und ganzen machte der seriöse Münzhandel nach einem kleinen Schockmoment weiter wie zuvor. Denn das Interesse an Münzen verschwand natürlich nicht. Viele Sammler freuten sich darüber, dass sie ihre Münzen zu einem unschlagbar günstigen Preis kaufen konnten. So behielten die Münzen auch in der Krise einen Geldwert. Der war allerdings wesentlich niedriger als noch ein paar Jahre zuvor. Es handelte sich also um das, was wir vom Aktienmarkt als Baisse kennen. Anleger, die in den späten 1980er und in den 1990er Jahren klug in Münzen investierten, freuen sich heute über eine exorbitante Rendite!
Einige wichtige Lehren 1 – Keine Medaillen kaufen
Wir hatten gerade gesagt, dass die Münzen ihren Sammlerwert (resp. ihren Nominalwert) behielten; für einen Großteil der modernen Medaillen galt dies nicht. Dazu gab es zu viele kunstlos produzierte Medaillen, für die der Käufer einen übertrieben hohen Zuschlag zum Metallwert gezahlt hatte. An Medaillen verlor ein Eigentümer also doppelt: Der Metallwert war dramatisch gesunken und kein Sammler hatte an diesen Scheußlichkeiten Interesse. All die teuer erworbenen Medaillenserien endeten in der Schmelze – so sie überhaupt aus Edelmetall bestanden. Dass die moderne Medaille heute noch ein so schlechtes Image hat, verdankt sie dem Preisverfall der 1980er Jahre.
Leider zogen diese Billigmedaillen auch die kostbaren Medaillenkunstwerke der Vergangenheit mit in den Abgrund. In den 1990er Jahren wurden Medaillen wesentlich günstiger verkauft als Münzen mit vergleichbarer Seltenheit. Mittlerweile erzielen Medaillen wieder höhere Preise – sind aber immer noch wesentlich günstiger als vergleichbare Münzen, und das obwohl Medaillen eigentlich sorgfältiger hergestellt wurden und attraktiver sind als die offiziellen Münzen eines Staates.
Einige wichtige Lehren 2 – Staatliche Gedenkmünzen
Auch staatliche Gedenkmünzen erlebten einen enormen Wertverfall. Am bekanntesten ist wohl das Beispiel der russischen Olympiamünzen, die anlässlich der Olympischen Spiele in Moskau von 1980 geprägt wurden. Sie waren zum hohen Silberpreis mit einem großzügigen Aufgeld für das Sammlerprodukt vermarktet worden und besaßen plötzlich nur noch Schmelzwert. Viele Käufer waren von den Angeboten, die sie für ihre teuer gekauften Stücke erhielten, derart frustriert, dass sie sie daheim liegen ließen. Wer das tat, konnte sich nach einigen Jahren über einen dramatischen Wertzuwachs freuen. Denn die Russen, die nach der Öffnung des Eisernen Vorhangs endlich Zugang zum internationalen Münzenmarkt bekamen, kauften mit Begeisterung (und Geldeinsatz) ihre Gedenkmünzen zurück.
Einige wichtige Lehren 3 – Nur seltene Münzen sind gute Münzen
Dabei stellte sich heraus, welch immense Rolle die Höhe einer Auflage spielt. Münzen, von denen nur wenige Stücke geprägt worden waren, legten wesentlich mehr an Wert zu als vergleichbare Objekte mit hoher Auflage.
Einige Investoren dachten weiter und überlegten, wie wichtig in diesem Zusammenhang der potentielle Kundenkreis ist. Deshalb erlebten die chinesischen Gedenkmünzen einen gewaltigen Boom nicht nur in Asien, sondern auch unter westlichen Spekulanten. Die kauften aus der Überlegung heraus, wie gigantisch der Pool an potentiellen chinesischen Sammlern ist. Mittlerweile hat sich der Hype etwas beruhigt, die Preise sind leicht zurückgegangen.
Einige wichtige Lehren 4 – Die Erhaltung ist das Wichtigste
Wir müssen uns klar machen, dass die Veränderungen der 1970er Jahre unumkehrbar waren. Der Münzhandel hatte sich zu einem internationalen Phänomen entwickelt. In der Praxis bedeutete das, dass ein Sammler aus einem wesentlich größeren Angebot von Münzen wählen konnte. Das hatte zur Folge, dass sich die Preisschere zwischen mittelmäßig und überdurchschnittlich erhaltenen Münzen öffnete.
Wir wissen alle, dass mittelmäßige Erhaltungen bei Münzen häufig vorkommen, während nur wenige Stücke überdurchschnittlich erhalten sind. Bei mittelmäßig erhaltenen Münzen konnte ein Kunde also darauf warten, bis er ein Stück zu einem günstigen Preis fand. Der Preis wurde zum entscheidenden Kriterium, eine solche Münzen zu verkaufen. Wer dagegen eine außergewöhnlich erhaltene Münze ersteigern wollte, stand in Konkurrenz zu Bietern aus der ganzen Welt. Wer sich unter diesen Bedingungen eine Münze sichern wollte, musste dafür überproportional viel Geld ausgeben.
Der zweite Teil dieses Artikels wird am 27. Februar 2025 veröffentlicht.