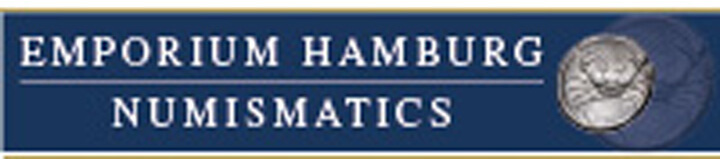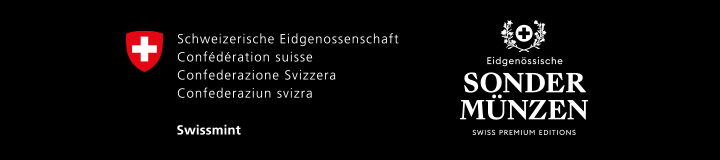Litauen schafft Ein- und Zwei-Cent-Münzen de facto ab – und stößt damit eine neue Debatte an
Von Sebastian Wieschowski
Litauen wird ab Mai 2025 auf die kleinsten Euro-Münzen weitgehend verzichten. Das baltische Land reiht sich damit als achter Eurostaat in eine wachsende Gruppe von Ländern ein, die beim Bezahlen auf das obligatorische Auf- und Abrunden setzen. Auch in Deutschland flammt die Diskussion über den Sinn der kleinen „Kupfermünzen“ erneut auf – konkrete Schritte gibt es dort aber noch nicht.
Inhalt
Seit Einführung des Euro 2002 wird regelmäßig über Ein- und Zwei-Cent-Münzen gestritten. Laut der jüngsten Eurobarometer-Umfrage der EU-Kommission aus Dezember 2024 befürworten 61 Prozent der Befragten eine Abschaffung der Mini-Münzen. Zwar lag der Wert im Jahr davor noch bei 65 Prozent, doch deutlich wird: Große Beliebtheit genießen die kleinsten Nominale nie – weder in den Ladenkassen noch in den Geldbörsen der Verbraucher.
Gerade erst hat Estland eine Rundungsregel eingeführt
In mehreren Ländern wie Belgien, Finnland, Irland, Italien, den Niederlanden, der Slowakei und Estland wird heute bereits auf Fünf-Cent-Beträge gerundet. Rechtlich sind Ein- und Zwei-Cent-Münzen aber weiterhin gültige Zahlungsmittel, da nur ein Beschluss auf EU-Ebene ihre vollständige Abschaffung ermöglichen würde. Solange dieser fehlt, bleibt es jedem Mitgliedstaat überlassen, die Münzen faktisch aus dem Umlauf zu nehmen.
In Litauen argumentiert die Zentralbank, dass die Kleinstmünzen erhebliche Ressourcen verschlingen. Derzeit seien rund 13 Waggons voller Kleinmünzen im Umlauf – viele davon würden nach nur einmaligem Gebrauch verschwinden, etwa in Sparschweinen oder Jackentaschen. Zwei Drittel der geprägten Ein- und Zwei-Cent-Münzen kehrten nie zur Bank zurück. Herstellung, Transport und Ersatzproduktion verursachten nicht nur hohe Kosten, sondern auch unnötige Umweltbelastungen, so die Bank.
Technische Herausforderungen
Technisch stellt die Umstellung auf Rundungsregeln einige Herausforderungen dar. Rimantas Mažulis vom Kassenhersteller Strong Point verweist laut der Tageszeitung „Wiener Standard“ darauf, dass sämtliche Kassensysteme angepasst werden müssen. Das bedeute kurzfristig Investitionen und Mehraufwand. Langfristig erwarte er aber eine Vereinfachung der Abrechnungsprozesse und somit auch Effizienzgewinne für den Handel.
Während in Litauen laut Umfragen rund 69 Prozent der Bevölkerung die Abschaffung der Kleinmünzen befürworten, ist die Stimmung in Deutschland gemischter. Dort sprach sich im März das Nationale Bargeldforum – ein Gremium aus Einzelhandel, Banken und Verbraucherschützern – erneut für ein Rundungssystem aus. Die Bundesbank verwies auf das Missverhältnis zwischen Herstellungskosten und Nutzen der Kleinstmünzen und appellierte an das Finanzministerium, gesetzgeberisch tätig zu werden. Politische Entscheidungen stehen allerdings noch aus.
Österreich hingegen verfolgt eine abwartende Linie. Die Oesterreichische Nationalbank erklärte bereits im März, man werde sich an den Wünschen von Handel und Konsumenten orientieren. Die Münze Österreich, die für die Prägung zuständig ist, stellte klar: Solange Nachfrage bestehe, werde man die Münzen weiterhin bereitstellen. Eine politische Initiative zur Abschaffung sei derzeit nicht absehbar.