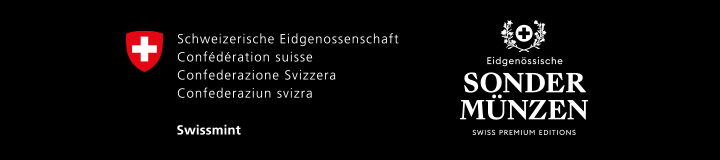Goldrausch in Kalifornien: Teil 2
Zahllose Geschichten berichten vom kalifornischen Goldrausch, der Tausende von Männern ins gelobte Land Amerika brachte. Doch nur wenige hat das Gold reich gemacht. Die meisten starben an den Strapazen der Reise, der Arbeit und der Enttäuschung, wenn sie ärmer in ihre Heimat zurückkehrten als sie gekommen waren. Ihre Geschichte soll hier erzählt werden.
Die Arbeit
Aber noch sind wir in der Anfangsphase, in der jeder – so schien es – das Gold vom Boden nur aufzuheben brauchte. Einige Neuankömmlinge hatten etwas überzogene Vorstellungen von dem, was sie im Gelobten Land erbeuten würden. So teilte einer von ihnen einem neugierigen Reporter mit, er hege keine besonderen Erwartungen. Wenn er täglich etwa einen Hut voll Gold aufsammeln könne, dann wolle er schon zufrieden sein.
Tatsächlich war die Goldgräberei harte Knochenarbeit und vom Boden aufsammeln konnte man das edle Metall höchstens in der Anfangsphase. Zu Beginn entdeckte man all die großen Goldablagerungen, die die Flüsse über Jahrtausende hinweg von den Hauptadern im Gebirge ins Tal hinunter gebracht hatten. An allen natürlichen Hindernissen hatten sich Goldnester gebildet, doch die waren bald alle von den unzähligen Goldsuchern ausgehoben.
An die eigentlichen Goldminen traute man sich zunächst nicht heran. Dafür gab es einen einfachen Grund. Dem einzelnen standen nicht die Kapitalmengen zur Verfügung, die man für die Ausbeutung einer Mine benötigt hätte. Und damit wird sofort klar, warum der Erfolg der Goldgräber zeitlich begrenzt sein musste: Sie konnten mit ihren relativ primitiven Schürfmethoden nur Ablagerungen ausbeuten, die sich während Jahrtausenden gebildet hatten. Aber da Zehntausende nach ihnen suchten, war es nur eine Frage der Zeit, wann die letzten entdeckt waren. Zwar versuchten einzelne Goldgräber, unterirdische Schächte anzulegen, aber sie kamen selten tiefer als ein oder zwei Meter. Dieses Verfahren nannte man coyoting, da man sich wie ein Koyote unter die Erde buddelte. Die wirkliche Ausbeutung der Mutteradern sollte den Generationen nach den Goldsuchern vorbehalten bleiben.
Zeitgenössische Karikatur eines Goldgräbers.
Die wenigsten Goldgräber waren Fachleute. Aber das, was sie wissen mussten, ließ sich schnell lernen. Die benutzten Techniken waren so einfach, dass jeder im Stande war, sie auszuführen. Meist war der mühsame Vorgang des Ausschwemmens nötig, um an das Gold heranzukommen. Alle benutzten Techniken beruhten auf der simplen Tatsache, dass Gold schwerer ist als alle anderen Materialien. Setzt man nun eine goldhaltige Flüssigkeit in Bewegung, so sinkt das Gold nach unten, während die anderen Materialien von der Bewegungsenergie getragen werden. Daraus resultierten mehrere Methoden mit einfachsten Werkzeugen.
Ein Goldgräber wäscht mit der Goldpfanne das wertvolle Metall aus dem Boden.
Das billigste aller Werkzeuge war die Goldgräberpfanne, auch wenn in der Anfangsphase des Goldrausches der Preis für so ein Kücheninstrument von 20 Cent auf über einen Dollar hochkletterte. In eine flache Pfanne wurde goldhaltiges Erdreich geschüttet. Man setzte die Pfanne in kreisende Bewegung und schwappte nach und nach das leichtere Material über den Rand. Im tiefen Pfannenboden sammelte sich dabei das schwere Gold.
Der Long Tom, ein Kanal, in dem ein künstliches Gefälle hergestellt wurde, in dem sich das schwere Gold an eingelassenen Leisten aufhalten ließ.
Dann gab es noch eine etwas aufwendigere Maschine mit dem Namen Long Tom. Diese besaß einen langen Kanal, über den das mit Wasser aufgeschlämmte Erdreich lief. Quer zum Kanal waren Leisten genagelt, die das nach unten sinkende schwere Gold auffingen. Aber damit war das Arsenal an Arbeitsmitteln eigentlich schon erschöpft.
Zeitgenössische Darstellung eines Goldfunds von 1853.
Erfolg und Mißerfolg
Die Technik des Goldwaschens war also leicht zu lernen. Schwieriger war es zu entscheiden, wo man den großen Fund machen konnte. Straßenkarten gab es nicht. So begaben sich die Neulinge zuerst in die großen Zentren Kaliforniens, nach Sacramento oder San Francisco, um sich zu orientieren. Dort erzählte man ihnen traumhafte Geschichten. So zum Beispiel die kalifornische Variante von Onkel Toms Hütte: Ein Goldgräber aus den Südstaaten hatte seinen Sklaven von daheim mitgebracht. Der träumte immer wieder, er fände unter einer der Hütten Gold. Darauf kaufte sein Herr die Hütte, und gemeinsam wuschen Herr und Sklave Gold für 20.000 Dollar aus dem aufgegrabenen Hüttenboden.
Oder die Geschichte vom erfolglosen Goldsucher. Der gab einem Felsen vor Wut einen Fußtritt. Der Fels fiel um und darunter kam ein riesiges Nugget zum Vorschein.
Oder der tote Goldgräber, dem seine Kameraden ein würdiges Begräbnis zukommen lassen wollten. Man hob für ihn eine Grube aus und einer seiner Kameraden hielt am offenen Grabe eine lange Predigt. Anscheinend hörte sich der Prediger gerne reden, denn einem der Knienden wurde es langweilig. Er ließ die lockere Erde am Grabesrand durch die Finger gleiten. Auf einmal schrie er auf: Er hatte Gold entdeckt. Die Beerdigung wurde beendet, der Leichnam aus der Grube geholt und die Trauergemeinde begann, nach Gold zu graben.
Gerüchte beherrschten die Szene. Schließlich hoffte jeder, irgendwann den großen Fund zu machen. Wie so ein Gerücht aussehen konnte, wissen wir aus einem Brief. „Es war uns vertraulich zu Ohren gekommen,“ schrieb ein Goldgräber namens Leeper, „dass jemand bestätigt hatte, dass jemand einen Mann gesehen hatte, der gehört hatte, wie ein anderer erzählte, er kenne einen jungen Mann, der absolut sicher sei, dass er einen anderen Burschen kenne, der, das wusste er bestimmt, zu einer Gruppe gehörte, die große Klumpen von Gold herausschaufelte.“
Ein zeitgenössischer Witz beschreibt den psychologischen Zustand der Goldgräber sehr genau: Der Goldgräber John Brown klopft an die Himmelstür. Petrus will ihn nicht hereinlassen. In seinem Himmel würden schon zu viele Goldgräber herumsitzen. John schlägt Petrus einen Handel vor: Wenn er ihm all die anderen Goldgräber innerhalb einer Woche vom Leibe schaffen könne, dann dürfe er selbst bleiben. Petrus geht darauf ein, und John Brown macht sich ans Werk, indem er dem einen oder anderen ganz vertraulich mitteilt, man habe in der Hölle Gold gefunden. Es dauert keine Woche, da sitzt nur noch John Brown im Himmel. Doch schließlich bittet auch er Petrus, in die Hölle gehen zu dürfen. „Aber warum,“ fragt Petrus, „Du hast doch selbst das Gerücht in die Welt gesetzt?“ „Nun,“ antwortet ihm John Brown, „aber es könnte trotzdem etwas dran sein.“
Leben im Defizit
Hatte sich ein Gerücht bewahrheitet, waren tatsächlich Goldfunde gemacht worden, die einer Reihe von Goldsuchern den Lebensunterhalt garantierten, dann dauerte es nicht lange und ein kleines Städtchen entstand. Diese Ansiedlungen nennen die Amerikaner Shantytowns. Shanty heißt umgangssprachlich Hütte oder Bude, und viel mehr als eine Ansammlung von Holzhäusern waren die Goldgräbersiedlungen alle nicht.
Die Goldgräberstadt Mormon Island. Das Bild wurde zwischen 1849 und 1854 angefertigt.
Sie trugen phantasievolle Namen wie Grizzly Flats, Hang Town oder Ben Hur und bestanden vor allem aus einem Laden, in dem Goldgräber sich mit allem, was sie zum Leben brauchten, versorgten.
So ein Laden diente als Gasthaus, Bar und Herberge, Lebensmittelgeschäft, Gemischtwarenladen, Bank, Wechselstube und Informationsbörse. Er war für seinen Besitzer die beste Goldgrube, musste doch jeder Goldgräber alles, was er zum Leben brauchte, dort kaufen. Nur in den seltensten Fällen gab es mehr als einen Laden in einem Goldgräbercamp; so hatte der Inhaber das Monopol. Und die Preise waren enorm. Ein entsetzter Reporter beschrieb in der Illustrated California Press ein Frühstück, das er in den Goldfeldern eingenommen hatte:
„Mac und ich gingen zum Frühstück. Unser Frühstück bestand aus folgenden Dingen: Einer Sardinenbüchse, einem Pfund Hartkekse, einem halben Pfund Butter, einem halben Pfund Käse und zwei Flaschen Bier. Wir aßen und tranken mit gutem Appetit, und als wir unser Essen beendet hatten, baten wir um die Rechnung. Sie war eine solche Kuriosität in den Annalen des Einzelhandels, dass ich sie aufbewahrt habe und hier veröffentlichen will. Eine Büchse Sardinen, 16 $; ein Pfund Hartkekse, 2 $; ein halbes Pfund Butter, 6 $; ein halbes Pfund Käse 3 $; zwei Flaschen Bier 16 $; alles in allem 43 $.“
Auch aus anderen Quellen wissen wir, dass die Lebenshaltungskosten in den Lagern unglaublich hoch waren. Kartoffeln und Zwiebeln, die als Mittel gegen den Skorbut eingesetzt wurden, kosteten einen Dollar pro Knolle. Ein Fässchen Mehl bis zu 800 $.
Die Waren wurden, da Kalifornien selbst praktisch nichts produzierte, per Schiff eingeführt. San Francisco war dafür der Hauptumschlagsplatz. Dort versteigerte man die Schiffsladungen an den meistbietenden Großhändler, der sie an Einzelhändler weiterverkaufte. Diese transportierten die Waren in die entlegenen Goldgräbercamps. Das war so teuer, dass der Endpreis der Ware oft nach Gewicht berechnet wurde, dass ein Kilo Nägel dasselbe kostete wie ein Kilo Äpfel oder Käse. Der ursprüngliche Einkaufspreis war gegenüber den Frachtkosten vernachlässigbar.
Es versteht sich von selbst, dass die Einzelhändler diesen mühsamen Transport nicht aus reiner Menschenliebe auf sich nahmen, sondern um Gewinn zu machen. 25 % galten dabei nicht nur als normal, sondern als gemäßigt. Schlechtes Wetter, das einzelne Camps monatelang vom Nachschub abschnitt, konnte die Gewinnspanne auf 400 % und mehr treiben. Die Händler waren die Gewinner des Goldrausches. Sie machten mit einem relativ geringen Risiko immense Gewinne. Und als allmählich die Ausbeutung der Mutterminen größere Kapitalmengen verlangten, sprangen sie mit ihrem angesammelten Vermögen in die Bresche.
Für einen Goldgräber war es schon schwerer mit seiner Hände Arbeit ein Vermögen zu erwerben. 1849 musste er täglich etwa für 5 $ Gold aus dem Boden holen, um seine Grundkosten zu decken. Die durchschnittliche Ausbeute betrug aber nur 1,80 $ in Placerville, und 1,65 $ in Angels Camp. Kein Wunder, dass die meisten Goldgräber auf keinen grünen Zweig kamen.
Nach 1850 hatten sich die Händler auf die neuen Bedürfnisse eingestellt und die Preise für Lebensmittel fielen. So wurde zwischen 1851 und 1856 das Goldgraben wieder rentabel, aber nach 1856 sank die tägliche Ausbeute so stark, dass sich kein Einzelgänger mehr halten konnte. Ihnen blieb die Rückkehr oder die Möglichkeit, sich bei einer der neuen Minengesellschaften zu verdingen.
Ausländerhass unter den Goldgräbern
Auf ausländische Konkurrenz waren die Goldgräber nicht gut zu sprechen. Besonders die Südamerikaner und Mexikaner hatten darunter zu leiden. Nicht nur, dass sie durch den viel kürzeren Anreiseweg wesentlich früher in Kalifornien angekommen waren. Sie verstanden oft auch mehr vom Bergbau als die amerikanischen Farmer, Rechtsanwälte und Ärzte. Betroffen von den Verfolgungen waren nicht nur die Mexikaner, sondern auch die Californios, die in Kalifornien geborenen Kalifornier mexikanischer oder spanischer Abstammung, die durch den Kauf Kaliforniens als Bürger der Vereinigten Staaten galten. Immer wieder kam es zu Aktionen gegen einzelne unerwünschte Ausländer oder zu Pogromen.
Porträt des Joaquin Murrieta von 1853.
Die Mexikaner suchten ihren eigenen Ausweg. Viele leisteten Widerstand in Form der organisierten Kriminalität. Berühmt geworden ist Joaquin, eine Art mexikanischer Robin Hood, der im Winter 1852/53 Calaveras County in Angst und Schrecken versetzte. Ihm wurde ein schreckliches, aber anscheinend durchaus glaubwürdiges Schicksal angedichtet. Die Yankees hätten ihn öffentlich auspeitschen lassen, seine Frau vergewaltigt, seinen Bruder ermordet, seinen Claim sowie sein Vieh gestohlen. Aus Rache beraubte er die reichen Amerikaner und beschenkte die Armen. Die Regierung schickte 20 Rangers aus, um ihn zur Strecke zu bringen. Drei Monate brauchten sie, um eine Bande Mexikaner zu fangen. Sie töteten und enthaupteten deren Anführer. Den Kopf legten sie in Alkohol ein und zeigten ihn als Joaquin in verschiedenen Goldgräberstädten. Allerdings ist es nicht restlos geklärt, ob sie wirklich Joaquin erwischt hatten. Die Zeitung Alta California berichtete, die Rangers hätten eine Gruppe von sieben einheimischen Kaliforniern überfallen, die wilde Mustangs einfing. Wir können heute den Wahrheitsgehalt dieser Geschichte nicht mehr überprüfen. Wichtig ist daran eigentlich nur, was man bei der damaligen Rechtspflege für möglich hielt.
Die Regierung unterstützte übrigens den Fremdenhass. So wurde die „foreign miners tax“ beschlossen, eine Steuer, die jedem Ausländer der in Kalifornien nach Gold graben wollte, monatlich 20 $ abforderte. Bei einem durchschnittlichen Einkommen von 1,65 $ pro Tag entsprach das der Ausbeute von guten 12 Tagen. Das war zu viel. Statt der erhofften 2.400.000 $ jährlich konnte der Staat gerade mal 30.000 $ verbuchen. Die meisten Ausländer zogen es vor, den Beruf aufzugeben, anstatt die ruinöse Steuer zu zahlen.
Löb Strauß, *26. Februar in Buttenheim / Oberfranken, + 26. September 1902 in San Francisco, bekannt als Levi Strauss, Erfinder der Blue Jeans.
Deshalb gab es wohl gerade unter den Ausländern märchenhafte Karrieren. Auf den Handel oder das Handwerk zurückgeworfen, zogen sie ohne großes Risiko ihren Kunden das Gold aus der Tasche. Der bekannteste dieser erfolgreichen Unternehmer ist wohl Levi Strauss, der in seiner oberfränkischen Heimat noch Löb Strauß geheißen hatte. Er kam 1850 in Kalifornien an und erkannte sofort, dass die Arbeitsbekleidung der Goldgräber verbesserungsbedürftig war. Anstatt Baumwolle oder Wolle benutzte Strauss Segeltuch für Hosen und verstärkte die reißanfälligen Nähte und Taschen mit Nieten. Die Jeans war geboren, die als Levi’s heute noch getragen wird.
Wenn Sie Teil 1 verpasst haben, können Sie den Text noch im Archiv nachlesen. Klicken Sie einfach hier.
Im nächsten und letzten Teil erfahren Sie, welche Auswirkungen der Goldrausch auf die Münzprägung hatte und welche Münzen wir dieser Epoche verdanken.