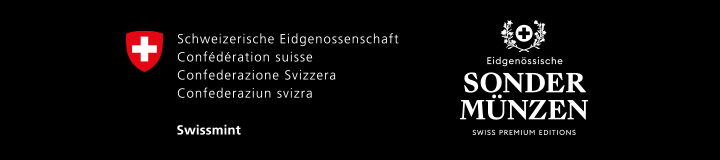Die Zürcher und ihr Geld 6: Was kostet das Seelenheil?
mit freundlicher Genehmigung des MoneyMuseum
In unserer Serie „Die Zürcher und ihr Geld“ nehmen wir Sie mit in die Welt des vergangenen Zürich. Um 1520 versucht eine Zürcherin, ihren Mann, einen Handwerkmeister davon abzuhalten, sich einen Ablass zu kaufen. Dazu gibt es wie auf einer guten DVD ein Making of, also welcher numismatisch-historische Hintergrund zu diesem Gespräch gehört.
Um 1520. Eine Zürcherin versucht, ihren Mann, einen Handwerkmeister, davon abzuhalten, sich einen Ablass zu kaufen. Gezeichnet von Dani Pelagatti / Atelier bunterhund. Copyright MoneyMuseum / Zürich.
Zürcherin: Bist Du wahnsinnig! Rück sofort den Guldiner wieder raus. Ich lasse nicht zu, dass sich die Pfaffen mit meinem Geld den Wanst vollstopfen.
Ehemann: Aber Weib, es geht doch um mein Seelenheil. Schau diesen Kirchweihablass gibt es doch nur einmal im Jahr, während der Festwoche von Felix und Regula. Ich habe schon gebeichtet und der Priester hat mir die Absolution erteilt. Und jetzt kann ich mich von den schrecklichen Qualen des Fegefeuers freikaufen. Sieben Jahre Fegefeuer bleiben mir für den Guldiner erspart, sieben Jahre für das bisschen Geld.
Bisschen Geld! Bisschen Geld! Weißt du, wie lange ich dafür habe sparen müssen. Das sind ja fast 10 Tageslöhne! Von dem Geld könnten wir fast einen Zentner Getreide kaufen! Und da sprichst Du von einem bisschen!
Ja, weißt Du, der Priester hat gesagt, ich soll ihm einen halben Monatslohn geben für den Ablass. Eigentlich ist der Guldiner ja noch zu wenig.
Jetzt hör aber auf. Diese Pfaffen, die fressen uns mit Haut und Haar!
Aber es ist doch für mein Seelenheil.
Da führ’ mal lieber ein Gott gefälliges Leben und geh nicht so oft ins Wirtshaus saufen. Der Herr Student hat mir das letzte Mal erklärt, dass das Ablasskaufen gar nichts bringt. Kirchen, Pfaffen und Gottesdienste, die gibt es doch schon genug! Das Geld sollte man lieber den Armen geben. Das wäre Gott gefällig! (Pause) Die Wachslichter da zum Beispiel, ja die zwölf Lampen, die da vor dem Grab brennen?
Sind sie nicht wunderschön?
Weißt du, was die im Jahr kosten? Der Herr Student hat’s ausgerechnet. Für das Wachs müssen die den Gegenwert von 19 einhalb Mütt Getreide geben, das ist mehr als eine Tonne! Stell Dir mal vor, wie viele Menschen man damit ernähren könnte! Abschaffen sollte man diese Lichter, einfach abschaffen, und die Bilder von den Heiligen sollte man gleich dazu aus den Kirchen werfen.
Aber das geht doch nicht!
Ach was, der Student hat mir das letzte Mal ein Gedicht beigebracht, willst Du’s hören?
Hast Du verbrennt viel Öl und Anken, (Schweizerdeutsch für Butter)
dann müssen dir die Mäuse danken.
Die haben des Nachts umso besser gesehen,
wäre besser, es wäre nicht geschehen.
Hättest Öl und Anken gegeben
den Armen, das wäre mir eben.
Dort wär’s Öl und der Anken besser anbracht,
Als dass er leuchtet den Götzen durch die Nacht.
Bist Du sicher, es freut die Heiligen wohl?
Die seh’n nämlich nichts, die sind hinten hohl.
Darstellung des Jüngsten Gerichts am Eingangsportal der Kathedrale von Leon. Foto: KW.
Making of:
Im Jahr 1336 erließ Papst Benedikt XII. einen Lehrentscheid, in dem er von katholischer Seite exakt fixierte, welchen Seelen der Himmel offen stand. „Im Himmel, im Himmelreich und im Himmlischen Paradies mit Christus, in Gemeinschaft mit den Heiligen“ sollten neben den heiligen Aposteln, Märtyrern, Bekennern und Jungfrauen diejenigen sein, „die nach Empfang der heiligen Taufe Jesu Christi gestorben sind und … die nach dem Tode gereinigt worden sind, wenn etwas in ihnen damals zu reinigen war“. Mit diesen Worten wurde der damals schon weit verbreitete Glaube an das Fegfeuer von höchst offizieller Seite sanktioniert.
Auch wenn sich die Strafen ähneln mochten, das Fegefeuer entsprach nicht der Hölle. Während die verlorenen Seelen der verstockten Sünder in der Hölle auf immer und ewig für ihre Taten büßten, war die Zeit, die eine Seele im Fegefeuer abzuleisten hatte, endlich. Als Voraussetzung, um überhaupt ins Fegefeuer und nicht in die Hölle zu kommen, galt es, die Schuld ehrlich bereut zu haben und von einem Priester davon freigesprochen worden zu sein. Nun musste die Sünde wieder gut gemacht werden, entweder durch einen Aufenthalt im Fegefeuer, oder – und das zogen im Mittelalter die meisten Menschen vor – durch Gebet, eine Spende an die Kirche, an die Armen oder eine Wallfahrt.
Für eine Spende gab es dabei die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Zunächst konnte man eine Donation machen, ein einmaliges Geschenk an eine kirchliche Institution übergeben. Dann kam eine Stiftung in Frage, ein großer Geldbetrag oder ein Immobilienbesitz, der „auf ewig“ ein Einkommen sichern sollte, mit dem gute Werke finanziert wurden, die der im Fegefeuer leidenden Seele den Aufenthalt an diesem garstigen Ort verkürzten. So wurde zum Beispiel mehr als die Hälfte der Mittel, die für das Wachs aufgebracht werden musste, das vor den Gräbern der Stadtheiligen Felix und Regula brannte, von Bauern als Steuerleistung erbracht, die auf Gütern arbeiteten, die Stifter dem Großmünster zu genau diesem Zweck vermacht hatten.
Eine dritte Möglichkeit setzte sich im Verlauf des 14. Jahrhunderts mehr und mehr durch, der Ablass. Auch wenn uns die Schriften der Reformatoren darüber hinwegtäuschen, war der Ablass ein beliebtes und begehrtes Mittel, seine Sündenschulden zu begleichen. Ein Ablass kam zwei Seiten zugute: Der kirchlichen Institution, die ihn mit päpstlicher Erlaubnis erteilen durfte, und dem Gläubigen, der sich für sein Geld eine exakt festgelegte Zeit im Fegefeuer ersparen konnte.
Ablasskrämer. Maske beim Schembartlauf Anfang des 16. Jahrhunderts. Quelle: Wikipedia. Ms. 351, Schembartbuch aus dem Besitz des Sebastian Schedel. Los Angeles, University of California, Library, Coll. 170.
Der Ablass, um den es in unserem Hörspiel geht, war auf Bitten des Zürcher Rates von Papst Sixtus IV. am 12. Juni 1479 ausgestellt worden. Auf fünf Jahre gewährte er jedem Gläubigen, der während der Felix- und Regulawoche Buße geleistet und geopfert hatte, den gleichen Ablass, als wenn er im Jubeljahr 1475 nach Rom gepilgert wäre. Das dabei gewonnene Geld wollte der Zürcher Rat für den Bau von Kirchen investieren, besonders der Neubau der Wasserkirche lag den Stadtvätern am Herzen. Nach fünf Jahren wurde dieser Ablass in einen „gewöhnlichen“ Kirchweihablass umgewandelt, bei dem der Gläubige „nur noch“ die Verzeihung für sieben Jahre Fegefeuerstrafe und zusätzlich sieben Quadragenen erwerben konnte. Unter einer Quadragene verstand man das Strafmaß, das mit einer Bußleistung von 40 Tagen abgegolten werden konnte.
Wer so einen Ablass erwerben wollte, der musste zunächst echte Reue zeigen. Ohne sie war auch die größte Geldspende nutzlos. Er musste beichten und wurde vom Priester für seine Schuld losgesprochen. Im Beichtgepräch legte der Seelsorger fest, wie viel der arme Sünder zu zahlen hatte. Von Reichen wurde oft der Gegenwert für 30 Tage Arbeit gefordert. Ärmere, und dazu rechnen wir hier unseren fiktiven Handwerkermeister, mussten einen halben Monatslohn bezahlen. Wer ganz arm war, also seinen Unterhalt durch Betteln erwarb oder so wenig verdiente, dass der Tageslohn ganz für das tägliche Brot aufgebraucht wurde, der konnte die Geldspende durch das Gebet ersetzen, wobei auch der Ärmste der Armen dazu gehalten war, zunächst zu versuchen, Geld aufzutreiben, indem er fromme Gläubige um eine an diesen Zweck gebundene Spende bat.
Zürich. Guldiner 1512. Die Stadtheiligen Felix, Regula und Exuperantius. Aus Auktion Künker 217 (2012), 3073.
Ob der hier abgebildete Guldiner tatsächlich einem knappen halben Monatslohn entsprach, können wir nicht mit letzter Sicherheit sagen. Leider liegen uns für das Jahrzehnt zwischen 1511 und 1520 keine Quellen vor, anhand derer wir den Tageslohn eines Handwerkermeisters ermitteln könnten. Für die Zeit zwischen 1541 und 1550 ist der Tageslohn eines Meisters mit 8 Schillingen anzusetzen. Für einen Guldiner hätte ein Meister also gute 4 1/2 Tage arbeiten müssen. Allerdings kostete in eben diesem Zeitraum das Mütt (54 kg) Kernen (= Getreide ohne Spelz) bereits 92 Schillinge und 6 Pfennige, also mehr als das Doppelte dessen, was es noch in den Jahren zwischen 1511 und 1520 gekostet hatte. Wir wagen deshalb die Hypothese, dass auch der Tageslohn unseres Meisters bei der Hälfte der 8 Schillinge lag, er also einen knappen halben Monat für den Guldiner hätte arbeiten müssen.
Das Gedicht übrigens ist – wenn auch der modernen Sprache angepasst – im Inhalt authentisch, allerdings etwas später entstanden. Es stammt von Utz Eckstein, der es in einer Flugschrift im Jahr 1525 verbreitet.
Die Kirche erfreute sich nicht nur wegen des Ablasshandels eines großen Reichtums. Im Zuge der Reformation enteignete die Stadt Zürich umgehend die katholische Kirche. Wie es danach zuging, erfahren Sie in der nächsten Folge „Der ‚Raub’ des Kirchensilbers“.
Alle anderen Folgen der Serie finden Sie hier.
Die Texte und Zeichnungen entstammen der Broschüre zur gleichnamigen Ausstellung im MoneyMuseum Zürich. Vertonte Auszüge sind als Video hier erhältlich.