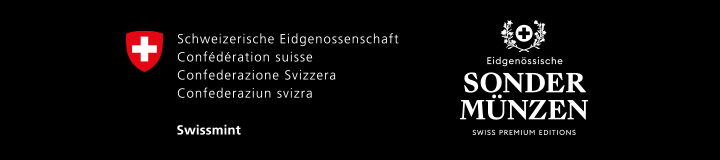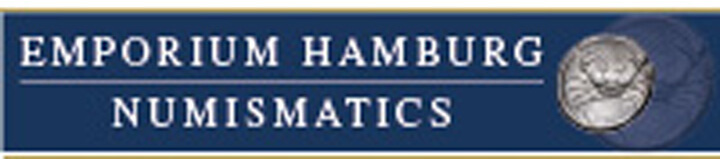Warum streiten wir uns, wie man Kulturgüter am besten schützt?
Jeder hat seine eigene Meinung in Sachen Kulturgutschutz. Alle Argumente liegen auf dem Tisch und sind bereits endlos wiederholt worden. Aber warum streiten eigentlich Archäologen mit Sammlern, wie man Kulturgüter am besten schützt? Sich die Entstehung des Streits vor Augen zu halten, hilft, einen Ausweg aus der Situation zu finden.
von Ursula Kampmann
Inhalt

Sammler vs. Archäologe
Jeder hat seine eigene Meinung in Sachen Kulturgutschutz. Alle Argumente liegen seit langem auf dem Tisch und sind endlos wiederholt worden: Sammler argumentieren, dass Staaten ihre Kulturgüter lieblos behandeln und kaum schützen. Archäologen halten dagegen, dass diese Kulturgüter nur wegen der Sammler in Gefahr sind. Sammler führen daraufhin auf, was sie für Museen und die Verbreitung von numismatischem Wissen tun. Archäologen gestehen das zu, interessieren sich aber kaum dafür, weil der Fundzusammenhang für sie das Maß aller Dinge ist.
Keiner von beiden hat ganz recht, aber beide Seiten haben gute Argumente. Wie so oft gibt es nicht Schwarz und Weiß, sondern viele Schattierungen von Grau.
Aber warum streiten Archäologen überhaupt mit Sammlern darüber, wie man Kulturgüter am besten schützt? Und welche Rolle spielten die Münzen dabei? Dieser Artikel fasst die Genese des Streits zusammen. An die Ursprünge zu gehen, ist wichtig, um gemeinsam einen Ausweg aus einem scheinbar ausweglosen Dilemma zu finden.
Lösung für ein urgriechisches Problem
Alles begann 1949, als der Griechische Bürgerkrieg zwischen Kommunisten und Monarchisten endete. Kulturministerin Melina Mercouri entwickelte ein Anliegen, um die tief gespaltenen Nation kulturell zu einen: Sie forderte die Rückgabe des Parthenonfrieses vom British Museum. Das war ein voller Erfolg! Nicht etwa, weil Griechenland den Parthenonfries zurückbekommen hätte. Das ist bis heute nicht geschehen und war auch nicht so wichtig. Wichtig war es, dass dieses Anliegen die Aufmerksamkeit aller Griechen auf ihr gemeinsames Erbe lenkte und so jenseits von Kommunisten und Monarchisten eine griechische Identität schuf.
Melina Mercouris Idee fiel in eine Phase, die wir heute als Dekolonisation kennen. Viele unter europäischer Herrschaft stehende Länder forderten ihre Freiheit und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Für ihr Nation Building spielte die gemeinsame Kultur eine zentrale Rolle. Doch viele Kunstwerke, die erhalten geblieben waren, befanden sich nicht im eigenen Land, sondern in den Museen der Welt. Ja, man könnte durchaus sagen, dass viele Kunstwerke nur deshalb erhalten geblieben waren, weil sie sich in den Museen der Welt befunden hatten. Nichtsdestotrotz richtete sich die Aufmerksamkeit der jungen Nationen auf eben diese Kunstwerke.
Was die Inflation mit den UNESCO Konventionen zu tun hat
Jetzt müssen wir an einen weiteren Faktor denken, nämlich die Inflation, die nach der Loslösung des Dollars vom Goldstandard im Jahr 1971 die westlichen Staaten plagte. Alle Bürger versuchten damals, ihr Geld inflationssicher anzulegen. So entwickelten sich Sammelobjekte zu Investitionsgütern. Vor allem Münzen erlebten einen Boom, weil sie für all diejenigen, die sich keine Immobilie, keinen Goldbarren leisten konnten, eine erschwingliche Alternative darstellten.
Verbrecher nutzten die steigende Nachfrage, um in Kriegsgebieten und in Ländern mit schwachen, korrupten Verwaltungen Kulturgüter zu rauben und sie auf dem internationalen Kunstmarkt anzubieten. Dagegen richteten sich die UNESCO Konventionen von 1970 und 1972. Sie beschäftigten sich mit den zentralen, für das Selbstbewusstsein einer Nation wichtigen Objekten. Münzen interessierten zu diesem Zeitpunkt niemanden.
Wieso sich die Archäologen gegen die Münzsammler wandten
Das änderte sich, als im Verlauf der 1970er Jahren kleine, erschwingliche Metalldetektoren auf den Markt kamen. Sie ermöglichten erstmals die systematische Suche nach Hort- und Einzelfunden. Menschen in wirtschaftlich schwachen, aber archäologisch interessanten Regionen investierten in einen Metalldetektor und begannen zu graben. Das ärgerte die Archäologen, weil ihre Schichten durcheinandergerieten. Durchaus verständlich. Aber die Archäologen waren eine winzige und elitäre Minderheit, die Hunderttausenden, vielleicht Millionen von Sammlern gegenüber stand. Wie konnte diese winzige Minderheit so einen gewaltigen Einfluss auf die öffentliche Meinung nehmen?
Das liegt daran, dass seit dem 19. Jahrhundert Archäologie, Macht und Regierungen eng miteinander verflochten sind. Nicht umsonst befindet sich der Parthenonfries in London. Und nicht nur er. Das British Empire dokumentierte seine Macht, indem es die Vergangenheit möglichst vieler Nationen erkundete. Dazu benutzte jede Großmacht ihre eigenen Institutionen. In Deutschland heißt diese Institution DAI, Deutsches Archäologisches Institut. Es hat noch heute Zweigstellen in Rom, Athen, Istanbul, Kairo, Madrid, Damaskus, Bagdad und Sanaa, Peking und Teheran, nicht zu vergessen Ulaanbaatar. Viel wichtiger aber ist, dass das Deutsche Archäologische Institut direkt dem deutschen Außenministerium zugeordnet ist und so die Aufmerksamkeit der Politik genießt.
Denken wir jetzt noch daran, dass das Fernsehen seit den 1970er Jahren das Radio an Beliebtheit überholt hat. Das bedeutet, dass seit den 1970er Jahren Bilder wichtiger sind als Worte. Und die Archäologie liefert tolle Bilder. Sie erlebt deshalb seit einem halben Jahrhundert einen ungebrochenen Boom auch bei der breiten Masse. Die mediale Aufmerksamkeit verschafft den Archäologen die Öffentlichkeit, ihre Sicht der Dinge massentauglich zu verbreiten. Nur so konnte es ihnen gelingen, die UNESCO Konventionen von 1970 und 1972 auf unbedeutende Kulturgüter wie Münzen zu übertragen.
(Zu) späte Reaktion der Regierungen
Damit liegen erst einmal alle Interessen auf dem Tisch. Und jetzt mischen wir dazu die Unzulänglichkeiten der Regierungen. Sie unternahmen Jahrzehntelang gar nichts, um Export und Import von Münzen zu regulieren bzw. gar zu überwachen. Meist genügte ein einfacher Import ohne Angabe der Herkunft oder gar Vorzeigen von Exportpapieren, um Münzen völlig legal handeln zu dürfen. Dieses staatliche Versäumnis der Vergangenheit befeuert heute die Kulturgutschutzdebatte. Es gibt seit den 1970er Jahren eine große Gruppe von Münzen auf dem Markt, deren Handel absolut legal ist, deren Herkunft aber heutigen moralischen Ansprüchen nicht (mehr) genügt.
Dazu kommt das Problem der Dokumentation. Bis weit nach der Jahrtausendwende wurde ein Großteil des Münzhandels nicht über Auktionen oder Verkaufslisten, sondern persönlich in einer Münzhandlung oder auf einer Münzbörse abgewickelt. Viele Stücke wurden wegen der hohen Fotokosten nicht abgebildet. Es ist also meist schwer bis praktisch unmöglich zu unterscheiden, welche Münzen vor dem Erlass der UNESCO Konventionen von 1970 und 1972 bereits gehandelt wurden, welche erst nach dem Erlass ins Land kamen.
Einigkeit und Raum für Verhandlungen
Hier können wir ansetzen. Denn selbst der radikalste Archäologe gesteht dem Sammler zu, Münzen aus alten Sammlungen weiter zu sammeln. Umgekehrt wird hoffentlich jeder Sammler wissen, dass Münzen aus frischen Raubgrabungen tabu sind. Das beschränkt die Diskussion auf Münzen, die seit den 1970er Jahren auf dem Markt sind und deren Provenienz nicht nachgewiesen werden kann.
Was soll mit diesen Millionen und Abermillionen von Münzen geschehen? Kein Museum der Welt ist in der Lage, sie zu lagern, zu dokumentieren und für zukünftige Generationen zu erhalten. Das kann nur die vereinte Schwarmintelligenz der Münzsammler.
Wir, die Sammler, müssen also Archäologen und Regierungen überzeugen, dass es in ihrem ureigensten Interesse ist, diese Münzen im Handel zu lassen, um sich auf die Verhütung von neuen Raubgrabungen zu konzentrieren. Gleichzeitig hat jeder Sammler die Aufgabe, bei all seinen Sammlerfreunden dahin zu wirken, nach bestem Wissen und Gewissen keine Münzen aus neuen Raubgrabungen zu kaufen. Wir brauchen eine neue Ethik des Münzsammelns, die den Kauf verdächtiger Münzen ächtet.
Nur so können wir langfristig das Sammeln von Münzen und Medaillen sichern und die bunte Welt der Numismatik erhalten, zu der Münzsammler, Münzhändler, Kuratoren und akademische Numismatiker gleichermaßen gehören. In dieser Welt hat jedes einzelne Mitglied die gleiche Existenzberechtigung. Aber genauso trägt jedes einzelne Mitglied die Verantwortung, die Buntheit der numismatischen Welt zu erhalten!