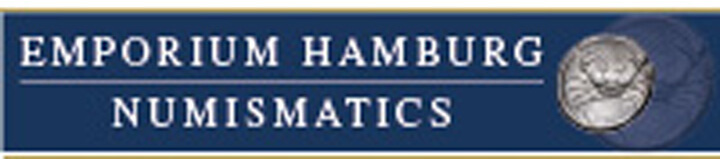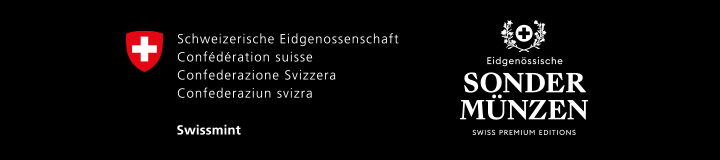Vor 400 Jahren: Gründung von Kongsberg
Am 2. Mai 1624 gründete Christian IV. von Dänemark und Norwegen die Bergbaustadt Kongsberg. Welche Hoffnungen er auf das Silber setzte, davon zeugt eine Serie von Münzen, die in der kommenden Künker-Auktion angeboten werden.
Inhalt
Es sollen, wenn wir einer romantischen Überlieferung glauben wollen, zwei kleine Kinder gewesen sein, die beim Hüten des Viehs auf einen hübschen, schimmernden Stein stießen und ihn heimbrachten. Der Vater erkannte sofort dessen Wert, schmolz ihn ein und versuchte ihn in der nächstgrößeren Stadt zu Geld zu machen. Natürlich wurde der Mann verhaftet. Wie kam ein armer Bauer zu so viel Silber? Man ließ ihm die Wahl zwischen lebenslanger Zwangsarbeit und der Preisgabe des Fundorts. Der Bauer entschied sich für letzteres, und damit begann der Bergbau in einer Region, die heute Kongsberg heißt.
Ein königlicher Besuch in Kongsberg
Die Beamten müssen die Aussage des Bauern sofort nach Kopenhagen gemeldet haben, denn am 12. Dezember 1623 drohte König Christian IV. allen Bewohnern Südnorwegens hohe Strafen an, sollten sie es versäumen, Silberfunde in ihrem Besitz den Vertretern des Königs zu übergeben. Nach der Schneeschmelze untersuchte der Freiberger Bergmeister Tobias Kupfer das von den Kindern entdeckte Silbererzvorkommen und meldete dem König, dass der Abbau profitabel sei.

Natürliches Silber aus Kongsberg im Gewicht von 11,5 Kilogramm. Norwegisches Bergwerksmuseum. Foto: KW.
Christian IV. war so erfreut, dass er sofort Dankgottesdienste in allen Kirchen der von ihm beherrschten Länder Dänemark und Norwegen abhalten ließ. Außerdem schrieb er an Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, um ihn um die notwendigen Fachleute für den Abbau zu bitten. In diesem Schreiben, datiert auf den 4. März 1624, erzählt der König eine ähnliche Geschichte über den Fund (übersetzt aus dem Frühneuhochdeutschen ins Hochdeutsche): Wir möchten Eurer Liebden hiermit freundlich melden, dass durch die wunderbare väterliche Fügung Gottes des Allmächtigen ein kleiner Hirtenjunge in unserem Königreich Norwegen, als es dort keine Hoffnung auf einige Silberbergwerke mehr zu geben schien, wie fleißig auch der Rutengänger und der vom sächsischen Kurfürsten uns geschickte Probierer danach suchten, und wie deshalb alle Bergwerke bis auf fünf aufgegeben wurden, gerade eben einen trefflichen Segen Gottes so entdeckt und geoffenbart hat, dass wir voller Zuversicht und Hoffnung sind, eine reiche Ausbeute zu erlangen.
Zu diesem Zeitpunkt dürfte Christian auch schon geplant haben, selbst nach Norwegen zu reisen. Er kam zwischen dem 27. und dem 29. April 1624 in das vielversprechende Gebiet und stieg selbst in die größte und ertragreichste Grube ein, die ihm zu Ehren den Namen Königsgrube erhielt.
Bereits auf der Heimreise gab er vor rund 400 Jahren der im Entstehen begriffenen Bergwerksstadt in einem Schreiben vom 2. Mai 1624 den Namen Kongsberg (= Königsberg).
Der Segen des Herrn macht reich
In diesen Zusammenhang gehört eine sehr besondere Serie von einfachen und mehrfachen Speciedalern, die das Osnabrücker Auktionshaus Künker in seinen Juni-Auktionen 408 und 409 anbieten kann. Schon ihre feine Stückelung weist darauf hin, dass zumindest die Mehrfachstücke, die 1624 in Kopenhagen geprägt wurden, weniger für den Umlauf als zu Geschenkzwecken gedacht waren.
Sie alle zeigen dieselbe Darstellung. Auf der Vorderseite sehen wir das gekrönte Brustbild des Herrschers mit der Umschrift (in Übersetzung): Christian IV, durch Gottes Gnade König von Dänemark, Norwegen, der Wenden und der Goten, Herzog von Schleswig und Holstein, Stormarn, Dithmarschen, Herzog von Oldenburg und Delmenhorst.
Auf der Rückseite finden wir das dänische Wappen auf einem Kreuz, das von den Wappen der Provinzen umgeben ist, die von der dänischen Krone bekrönt werden. Die Darstellung wird von der Schrift durch die Ordenskette des dänischen Elefantenordens abgegrenzt.
Das Entscheidende aber ist die Umschrift, denn sie spielt auf die Funde von Kongsberg an. Sie lautet (in Übersetzung): Der Segen des Herrn macht reich. Entnommen ist dieses Zitat den Sprüchen Salomo 10, 22. Anfang des 17. Jahrhunderts waren die gebildeten Betrachter dieser Münzen noch wesentlich bibelfester als wir das heute sind. Deshalb ergänzten sie automatisch: Der Segen des HERRN macht reich ohne Mühe. Mit anderen Worten: Christian IV. war sich sicher, dass Gott ihm durch den Silberfund ein Zeichen gegeben hatte. Gott hatte Christian auserwählt, die Sache der Protestanten zu verteidigen und ihm durch das Silber die Mittel anvertraut.
Die Protestanten und die Restitution
Man kann diese Aufschrift also als ein politisches Statement verstehen. Christian IV. war selbst gläubiger Protestant und herrschte über ein protestantisches Reich. Er gehörte darüber hinaus als Herzog von Holstein zusammen mit dem Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel zu den mächtigsten Fürsten im Niedersächsischen Reichskreis, und dessen Stände hatten damals ernsthafte Probleme. Sie hatten nämlich nicht nur den protestantischen Glauben eingeführt, sondern auch den gesamten Besitz der Kirche gegen alles gültige Reichsrecht konfisziert. Nun forderte Ferdinand II. die Rückgabe, und es sah ganz so aus, als würde er diese mit militärischer Macht erzwingen können.
Deshalb war der Silbersegen von Kongsberg so willkommen! Die protestantische Seite erhoffte sich, dass Christian IV. damit genug Söldner würde finanzieren können, um der kaiserlichen Forderung entgegenzutreten. Natürlich hatte auch Christian IV. seine Agenda. Er hoffte, die Gebiete von ein oder mehreren reichen Bistümer unter die eigene Kontrolle zu bringen.
Christian IV. als Vorkämpfer des Protestantismus
Im Frühsommer des Jahres 1625 wählten die Vertreter des Niedersächsischen Reichskreises Christians IV. zum Kreisobristen, allerdings mit der Auflage das Gebiet des Kreises nicht zu verlassen und ausschließlich defensiv zu agieren. Schließlich war es als Kreisobrist seine eigentlich Aufgabe, den Landfrieden zu wahren. Dies sollte er tun, indem er die Restitutionspläne des Kaisers unterband.
So machte sich Christian IV. daran, sein Heer so weit zu vergrößern, dass er den kaiserlichen Truppen Widerstand würde leisten können. Leider blieb die Ausbeute von Kongsberg weit hinter seinen Erwartungen zurück. In den Jahren zwischen 1623 und 1627 betrug die Ausbeute ganze 4.937 Mark feinen Silbers. Dem standen aber die Kosten für die Erschließung der Gruben und der Anteil der hoch bezahlten Bergarbeiter gegenüber.

Goldgulden nach rheinischem Vorbild, 1625, Kopenhagen. Sehr selten. Sehr schön. Aus einer norddeutschen Privatsammlung. Taxe: 1.500 Euro. Aus Auktion Künker 409 (20. und 21. Juni 2024, Nr. 1534.
Die Goldgulden, die nach dem Vorbild der rheinischen Gulden entstanden, um die Söldner zu bezahlen, wurden also aus geliehenem Gold geprägt. Dank der Silberbergwerke von Kongsberg hatte Christian IV. Kredit.
Doch dem Finanzgenie Wallenstein, der für den Kaiser auf eigene Kosten eine Armee von 50.000 Mann aufstellte, war Christian IV. weder militärisch, noch ökonomisch gewachsen. Da half es auch nicht, dass er 1628 einen Teil seiner Anteile an der Königsgrube an private Unternehmer verkaufte. Er musste am 27. Mai 1629 den Frieden von Lübeck unterzeichnen. Und dabei hatte er noch Glück im Unglück: Die kaiserliche Partei wollte nämlich durch äußerst milde Bedingungen verhindern, dass er sich mit dem schwedischen König verbündete. Gustav Adolf stand nämlich schon in den Startlöchern. Der schwedische Reichstag hatte ihm am 18. Januar 1629 das Mandat für sein Eingreifen auf Reichsgebiet erteilt.
Kongsberg heute
Christian IV. blieben von seinen hochtrabenden Plänen nur Schulden. Er verfügte deshalb über kein Kapital, um den Kongsberger Silberabbau selbst zu betreiben. Deshalb blieb ihm nichts anderes übrig, als seine Anteile an die Silberkompanie zu verkaufen. Sie betrieb den Bergbau auf eigene Kosten, musste aber ein Zehntel der Ausbeute an die königliche Schatzkammer abführte und den Rest zu einem festen Preis verkaufen.
Gerade für die deutschen Bergleute waren diese Konditionen nicht mehr attraktiv. Außerdem herrschte in der deutschen Heimat nun Frieden. Sie kehrten also in den Harz zurück. Vielleicht wäre der Bergbau unter diesen Umständen ganz eingestellt worden, hätte nicht Obersteiger Hans Bautz 1654 eine neue, reichhaltige Silberader entdeckt. Der Schacht, der zu ihr führte, erhielt den Namen Gottes Hilfe in der Not. Nun erst brach die große Zeit von Kongsberg an. In der ersten Hälfe der 1660er Jahre erzielte der Bergbau einen Reingewinn von ca. 100.000 Talern. Bis zur Schließung des Bergwerks im Jahr 1958 sollen die Silbergruben von Kongsberg insgesamt 1.350 Tonnen Silber geliefert haben.
Von ihrer Bedeutung kann sich heute noch jeder überzeugen, der das Norwegische Bergwerksmuseum in Kongsberg besucht. Es hat eine Nebenstelle, wo Touristen in den Christian VII.-Stollen und die Königsgrube einfahren können.
Wenn Sie mehr wissen wollen:
Hans-Heinrich Hillegeist, Auswanderungen Oberharzer Bergleute nach Kongsberg / Norwegen im 17. und 18. Jahrhundert. In: Hans-Heinrich Hillegeist und Wilfried Ließmann (Hrsg.): Technologietransfer und Auswanderungen im Umfeld des Harzer Montanwesens. (= Harz-Forschungen, Band 13), S. 9–48.