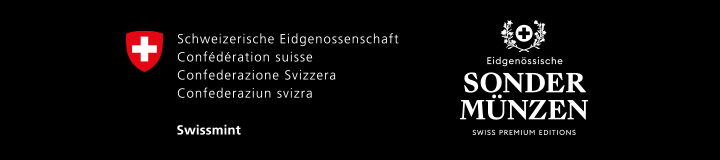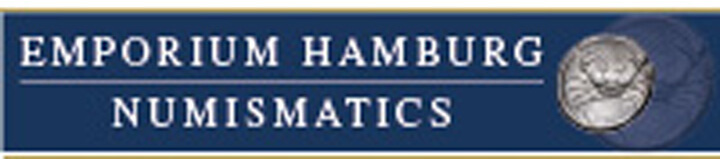Probe zur Kriegerverdienstmedaille I. Klasse – Ein bisher unbekanntes Zeugnis deutscher Kolonialgeschichte
von Helmut Caspar, im Auftrag der Leu Numismatik AG
Wer in Zeiten der Monarchie um angebliche Verdienste für Gott, Kaiser und Vaterland nicht mit blitzenden Ordenssternen und bunten, am Hals zu tragenden Kreuzen ausgezeichnet wurde, bekam, wenn er Glück hatte, Medaillen aus Gold und Silber. Nicht immer kamen alle ursprünglich geplanten Auszeichnungen zur Ausgabe, denn manche existieren nur als Entwurf, wie im Falle einer vom Berliner Medailleur Emil Weigand (1837–1907) geschaffenen „Kriegsverdienstmedaille“ aus dem Jahr 1893. Sie steht exemplarisch für ein Auszeichnungssystem, das Loyalität und Tapferkeit honorierte, zugleich aber untrennbar mit der gewaltsamen Realität des deutschen Kolonialismus verbunden ist. Eine Nachfrage im renommierten Berliner Münzkabinett ergab, dass sie dort fehlt und näheres über Ihre Entstehungsgeschichte bisher unbekannt ist.
Am 11. Mai 1892 stiftete Kaiser Wilhelm II. die „Kriegerverdienstmedaille I. Klasse für deutsche Schutzgebiete“ als Auszeichnung für Tapferkeit, die an indigene Soldaten (Askari) verliehen wurde, die in der berüchtigten Schutztruppe von Deutsch-Ostafrika dienten bzw. dienen mussten und die Hauptlast der Kämpfe in den Kolonien während des Ersten Weltkrieges trugen. Ab dem 25. März 1893 wurde sie auch an Mitglieder der Schutztruppe in Deutsch-Neuguinea, Tientsin, Kiautschou und weiteren Kolonialgebieten verliehen.
Die Medaille wurde in zwei Klassen ausgegeben, gefertigt aus vergoldetem und einfachem Silber. Die zweite Klasse entsprach der bereits 1873 eingeführten Kriegerverdienstmedaille und zeigt das Monogramm Kaiser Wilhelms auf der Vorderseite (OEK 1894). Das Vorderseitendesign der ersten Klasse wurde vom renommierten Berliner Medailleur Emil Weigand entworfen und zeigte Wilhelm II. mit Pickelhaube und Kürass des Regiments Garde du Corps. Die Rückseite beider Klassen trug die Inschrift „KRIEGER / VERDIENST“.

Die in der Auktion 18 der Leu Numismatik AG in Zürich am 2. Juni 2025 angebotene Auszeichnung (Los Nummer 1126), ist das bisher einzig bekannte Exemplar dieses Typs (38 mm, 24.46 g).
Das hier zu besprechende Exemplar aus Bronze ist in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich und gibt Einblick in die sonst wenig bekannten Ursprünge dieser seltenen Auszeichnung. Die Rückseiteninschrift „KRIEGS / VERDIENST“ wurde von preußischen Auszeichnungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts übernommen (OEK 1892). In der finalen Ausführung der Kriegerverdienstmedaille wurde diese jedoch durch „KRIEGER / VERDIENST“ ersetzt. Hermann von Heyden dokumentierte ein Musterexemplar der zweiten Klasse in Silber, das eine identische Rückseite wie das vorliegende Stück aufweist (H. von Heyden: Ehren-Zeichen der erloschenen und blühenden Staaten Deutschlands und Österreich-Ungarns, Frankfurt a. M. 1897, S. 49). Ein Muster der ersten Klasse ist in der Literatur bislang nicht belegt, und sein genauer Hintergrund bleibt ungeklärt. Unser Stück lässt jedoch vermuten, dass ursprünglich auch eine erste Klasse in Bronze vorgesehen war. Der Stempelschnitt der Kriegerverdienstmedaillen und unserer Probe entsprach den höchsten Standards der Zeit. Die letztendlich ausgeführten Exemplare wurden nur sehr selten verliehen, wodurch sie heute zu den großen Raritäten der deutschen Kolonialgeschichte zählen.
Die Vorderseite dieser Medaille, mit dem kaiserlichen Brustbild in der Uniform und dem Adlerhelm des renommierten, damals in Potsdam stationierten Regiments Garde du Corps, wurde 1890 bereits für die Münzen der 1885 gegründete Kolonie Deutsch-Ostafrika (DOA) verwendet (Jaeger 711–714). Der am kaiserlichen Hof in Berlin hoch angesehene Emil Weigand hatte ursprünglich in seinen Entwürfen dem 1888 auf den Thron gelangten Kaiser die Reichskrone aufsetzen wollen. Doch bestimmte Wilhelm II. den Gardehelm als Kopfschmuck.

Deutsch-Ostafrika, Rupie 1890, Jaeger 713, aus der Sammlung Dr. Max Blaschegg (1930-2021), Leu Webauktion 22, 20.–21. August 2022, 808 und zuvor gekauft bei Dorotheum Wien am 22. Oktober 1947.
Emil Weigand hatte seinen Beruf als Münzgraveur von der Pike auf erlernt. 1887 zum Ersten Münzmedailleur an der Königlichen Münze zu Berlin ernannt, schuf er zahlreiche Stempel für die Kursmünzen des Deutschen Reichs und einige seiner Bundesstaaten. An der Gestaltung der erst 1901 wieder zugelassenen Gedenkmünzen war er nicht mehr beteiligt. Er zog sich 1905 ins Privatleben zurück und starb, hoch geehrt, ein Jahr später. Emil Weigands Werk umfasst eine Vielzahl von Münzen und Medaillen. Von ihm stammen beispielsweise die Stempel zu den Bildnisseiten der Siegestaler König Wilhelms I. von Preußen sowie diejenigen der Zehn- und Fünf-Mark-Stücke in Gold und der Zwei- und Fünf-Mark-Stücke in Silber Kaiser Wilhelms I. und die seiner Nachfolger Friedrich III. und Wilhelms II. Dazu kamen auch Prägungen für Hamburg, Lübeck, Oldenburg, Sachsen-Altenburg und Waldeck. Nicht zu vergessen seien zudem seine Auftragsarbeiten für die Kolonialreiche.

Offizielle Geschenkmedaille für Ehejubiläen im Deutschen Kaiserreich, entworfen 1889 von Emil Weigand. Leu Webauktion 25, 11.–14. März 2023, 3823.
Über seinen numismatischen und phaleristischen Seltenheitswert hinaus gibt die eingangs präsentierte Probe einen tiefen Einblick in die koloniale Vergangenheit Deutschlands und die Auszeichnungspraxis der Schutztruppe. Kaiser Wilhelm II. tritt uns auf der Medaille, gerüstet mit Helm und Kürass, als wehrhafter Kolonialherr entgegen. Mit der Verleihung dieser Medaillen sollten die Indigenen in den Diensten des Deutschen Kaiserreichs Teil des Kolonialapparats werden, ohne die Grenzen zwischen Kolonialherren und Dienern zu verwischen. Schließlich wurden diese Medaillen ausschließlich Indigenen verliehen, während für die weißen Soldaten andere Auszeichnungen vorgesehen waren.