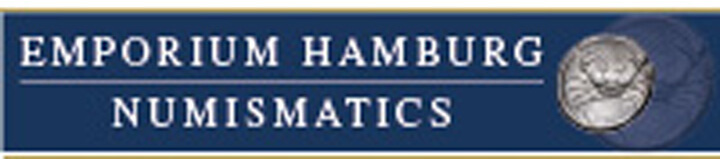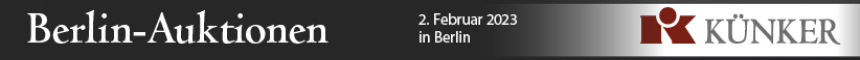Wir befinden uns im Umbau
Aktuell befindet sich die MünzenWoche im Umbau. Um Ihnen weiterhin den Zugang zum Archiv zu ermöglichen, haben wir kein Baustellenzeichen geschaltet, sondern arbeiten mit stellvertretenden Beiträgen. Alle Platzhalter werden bis zum 15. September durch neue, spannende, aktuelle Beiträge ersetzt.
Inhalt
Lorem Ipsum
Beginnen wir unsere Reise durch Zeit und Raum in Münster, genauer gesagt im Friedenssaal des Ratshauses. Dort hängen die Porträts derer, die eine wichtige Rolle für den Westfälischen Frieden spielten. Von prominenter Stelle blickt ein Mann herab, von dem die wenigsten je gehört haben: Johann Maximilian, Graf von Lamberg, Plenipotentiar der heiligen kaiserlichen Majestät. So lautet jedenfalls die Aufschrift des Porträts. Plenipotentiar? Auch dieses Wort wird kaum jemand kennen. Es setzt sich zusammen aus den lateinischen Wörtern für „voll“ und „Macht“. Johann Maximilian von Lamberg war also der Mann, der die Vollmacht besaß, einen Vertrag im Namen des Kaisers zu unterzeichnen. Und das tat er auch. Seine Unterschrift, gleich unter der von Königin Christina, gab dem Frieden von kaiserlicher Seite seine Gültigkeit.
Wer war dieser Mann, dem der Kaiser so sehr vertraute, dass er einen Vertrag von solcher Reichsweite für ihn unterzeichnen durfte?
Johann Maximilian von Lamberg wurde 1608 als Sohn eines Freiherrn geboren. Kein hoher Adel also, aber ein Stand, der Optionen bot. Der Vater ließ den Sohn studieren und finanzierte die Grand Tour, jene wichtige Kavaliersreise durch Europa, während der ein junger Mann Verbindungen knüpfte, höfisches Benehmen und Sprachen lernte. Damit war Johann Maximilian für die Verwaltungslaufbahn an einem Fürstenhof qualifiziert. Danach hatte er einfach Glück: Kaiser Ferdinand II. wurde auf ihn aufmerksam und nahm ihn in seine Dienste. Johann Maximilian war intelligent und konnte mit Zahlen umgehen. Der Kaiser sah das und teilte ihn seinem Sohn, dem späteren Kaiser Ferdinand III., als Finanzverwalter zu.
Johann Maximilian muss seine Sache sehr gut gemacht haben. Denn er gewann das Vertrauen von drei Kaisern: von Ferdinand II., von Ferdinand III., und weil der Johann Maximilian zum Erzieher seines Sohnes Leopold bestellte, auch noch von Leopold I.
Johann Maximilian machte eine Bilderbuchkarriere und wurde einer der Chef-Diplomaten der Habsburger. Das implizierte für ihn die Heirat mit einer reichen Erbin bester Abstammung und die Erhebung in den erblichen Reichsgrafenstand. Die Betonung liegt auf erblich. Denn durch ihn stieg das Geschlecht der Lamberg in die Führungsschicht des Reiches auf.
So reiste Johann Maximilian nach Westfalen, um dort über das Ende des 30-jährigen Krieges zu verhandeln. Er teilte sich die Verantwortung mit einem angeheirateten Verwandten: Graf Maximilian von und zu Trauttmansdorff-Weinsberg war der Großvater der Gattin von Johann Maximilians ältestem Sohn und Erben. Damit hatte der Kaiser die Zusammenarbeit zwischen den beiden Diplomaten sichergestellt. Sie teilten sich neidlos die Zuständigkeiten auf. Trauttmansdorff-Weinsberg agierte in Münster, Lamberg in Osnabrück.
Wie nun schildern die Medaillen diesen Vorgang? Gar nicht. Sie schweigen sich über die Diplomaten aus, wie die hier gezeigte Goldmedaille von Münster aus Auktion 424 illustriert. Ihre Umschrift spiegelt vor, es wären nur Kaiser und Könige notwendig gewesen, die mit ihrem Handschlag den goldenen Frieden begründet hätten. Genau wie unzählige Bilder und Flugblätter es taten. Nun, sicher gaben die Herrscher Richtlinien vor; aber für die praktische Umsetzung brauchte es fähige Mitarbeiter.
Die verhandelten natürlich nicht aus altruistischen Gründen. Sie erhielten ihre Belohnung, wenn es ihnen gelungen war, einen günstigen Vertrag abzuschließen. Für Johann Maximilian bedeutete der Westfälische Frieden den Orden vom Goldenen Vlies und kaiserliche Protektion für seine Söhne.

Johann Philipp von Lamberg. Dukat 1698 als Bischof von Passau, geprägt in Augsburg. Sehr selten. Vorzüglich. Schätzung: 5.000 Euro. Aus Auktion Künker 424 (3. Juli 2025), Nr. 640.
At vero eos et accusam
Was das konkret bedeutete, möchten wir am Beispiel von Johann Philipp von Lamberg zeigen, dem 1651 (oder 1652) geborenen, vierten und jüngsten Sohn von Johann Maximilian. Wir müssen uns dabei bewusst sein, dass die Chancen eines Adligen im Verhältnis zu seiner Stellung in der Erbfolge abnahmen. Ein vierter Sohn? Der konnte auf nicht allzu viel hoffen. Dass Johann Philipp dennoch in den Kreis der führenden Politiker aufstieg, verdankte er den Verbindungen seines Vaters sowie dessen hervorragender Planung.
Johann Maximilian hielt seinem Sohn nämlich zwei Optionen offen: Der junge Mann mochte in den diplomatischen Dienst treten oder eine Karriere in der Kirche machen. So durchlief Johann Philipp eine Ausbildung, wie sie ein Diplomat brauchte. Er studierte die Rechtswissenschaften in Wien, Steyr und Passau. Danach absolvierte er die Grand Tour, während der er von der Universität Siena promoviert wurde. Das verschaffte ihm 1676 das Amt eines kaiserlichen Hofrats. Auch Johann Philipp erwies sich als fähig und entwickelte sich zu einem der führenden Diplomaten.
Gleichzeitig sicherte Johann Maximilian seinem jüngsten Sohn alle Kirchenämter, die dieser ohne die höheren Weihen bekleiden konnte, und die eine Option auf einen Bischofsstuhl boten. Mit elf Jahren wurde Johann Philipp Domherr in Passau, mit sechszehn Domherr in Olmütz und mit dreiundzwanzig Domherr in Salzburg.
Als nun am 16. März 1689 der Passauer Bischof starb, ließen alle Mitglieder des Geschlechts der Lamberg ihre Verbindungen spielen. Zum Kaiser. Zum bayerischen Kurfürsten (der rechnete sich zu dem Zeitpunkt noch aus, dass er ihre Unterstützung gut würde brauchen können, um seine eigenen Ansprüche auf das spanische Erbe zu befördern). Wahrscheinlich waren noch viel mehr Personen involviert. Wir wissen heute einfach nichts mehr darüber. Jedenfalls wählte das anfangs ziemlich unwillige Domkapitel schlussendlich Johann Philipp am 24. Mai 1689 zum neuen Bischof. Am 11. Mai 1690 erfolgte die Bestätigung durch den Papst, am 14. Mai 1690 die Bischofsweihe.

Johann Philipp von Lamberg. Taler 1706, Regensburg, als Kardinal. Nur 800 Exemplare geprägt. Fast vorzüglich. Schätzung: 5.000 Euro. Aus Auktion Künker 424 (3. Juli 2025), Nr. 649.
Als Fürstbischof von Passau besaß Johann Philipp das Privileg, Münzen zu prägen. Eine kleine Auswahl der von ihm in Auftrag gegebenen Münzen werden in Auktion 424 angeboten. Sie entstanden übrigens nicht mehr in Passau. Die dortige Münzstätte war 1682 geschlossen worden. Es war für Johann Philipp wirtschaftlicher, die Aufträge an die gut eingerichteten Münzstätten in Augsburg und Regensburg auszugeben, als selbst eine neue Münzstätte auszustatten. Gerade die Regensburger Münzstätte bot darüber hinaus logistische Vorteile. Schließlich hielt sich Johann Philipp von Lamberg häufig genug in Regensburg auf, um im Auftrag des Kaisers am Immerwährenden Reichstag teilzunehmen.
Daran erinnert eine interessante Gruppe von Medaillen, die Johann Philipp von Lamberg als diplomatische Geschenke schaffen ließ. Sie alle zeigen auf der Vorderseite das Porträt Johann Philipps im vollen Ornat. Auf der Rückseite führt ein Putto einen mächtigen Löwen an einer dünnen Kette. Die Umschrift lautet in Übersetzung: Es vollbringt die ruhige Macht, was die gewaltsame [Macht] nicht vermag.
Takimata Sanctus
will in seinem Buch über die Prägung der Passauer Bischöfe dieses Motiv mit einem konkreten Anlass verbinden. Zur Auswahl steht ein Vertrag mit Bayern (Löwe!) und eine Einigung mit der Passauer Bürgerschaft. Beide Thesen sind aber widerlegt durch die Tatsache, dass Johann Philipp die Rückseite während seiner gesamten Regierungszeit praktisch unverändert beibehält: Die erste Medaille dieses Typs entstand 1691, die letzte 1705.
Es ist also wesentlich wahrscheinlicher, dass wir mit diesen Medaillen ein Zeugnis vom Selbstverständnis Johann Philipps besitzen. Was wäre auch passender für einen Diplomaten als die Kunst der sanften Überzeugung zu preisen?