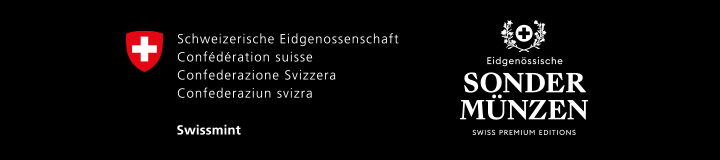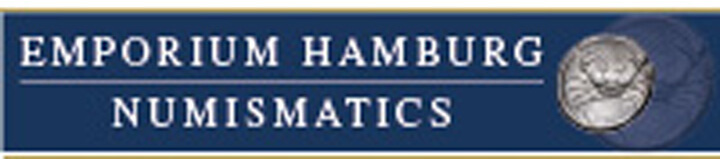Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst.
Dukat 1686 LCS, Berlin.
Äußerst selten.
Prachtexemplar.

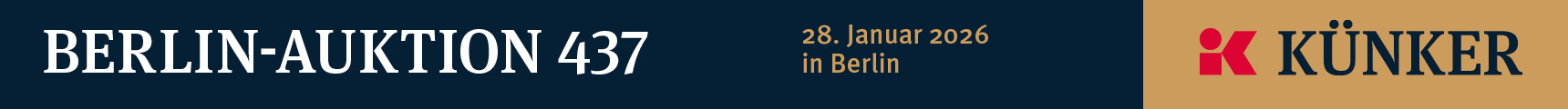
Maximilian II. Dukat 1855.
Nur wenige Exemplare bekannt.
Vorzüglich-Stempelglanz.

Ferdinand Albrecht I.
Löser zu 4 Reichstalern 1670, Clausthal.
Äußerst selten.
Prachtexemplar.

Friedrich Adolf.
5 Dukaten 1711, Detmold.
Einzig bekanntes Exemplar.
Vorzüglich-Stempelglanz.

6 Dukaten o. J. (1765-1790),
mit Titel Josephs II.
NGC MS 62 PL.
Äußerst selten.
Prachtexemplar von polierten Stempeln.

Johann Adolf, 1590-1616.
Portugalöser (10 Dukaten) o. J., Eutin.
Von größter Seltenheit und
besonderer geldgeschichtlicher Bedeutung.
Attraktives Exemplar.

Leopold I., 1657-1705.
20 Dukaten o. J. (nach 1666), Hall, von M. König.
Ehrenpfennig.
Äußerst selten.
Fast vorzüglich.

Und wieder ein Millionenergebnis: Wie stellt sich die Numismatik in den Tagesmedien dar?
Es ging ein Rauschen durch den Medienwald: NAC erzielte in Zürich für ein 100 Dukatenstück 1,9 Mio. Schweizer Franken. Prima Reklame für die Numismatik? Oder vermitteln wir mit diesen Rekordergebnissen ein falsches Bild vom Münzsammler?
von Ursula Kampmann
Inhalt

Ferdinand III. 100 Dukaten 1629, Prag. NGC AU58. Viertes bekanntes Exemplar. Aus Traveller Collection, Auktion NAC 162 (6. November 2025), Nr. 1008. Zuschlag: 1,9 Mio. CHF.
Es ist eigentlich ganz einfach, als Auktionshaus in die Tagesmedien zu kommen. Man braucht dazu ein Ergebnis mit vielen Nullen und eine ausgezeichnete Presseagentur. Wenn dann noch eine super Story mit der Münze verbunden ist, kann nur noch ein Kriegsausbruch in Europa oder ein Skandal im Königshaus die Berichterstattung verhindern. Denn der Münzhandel hat Geschichten zu erzählen, wie sie die Menschen lieben: Von Schätzen und märchenhaftem Reichtum, wie ihn jeder Leser selbst gerne hätte. Dass Gold immer noch glänzt, ist auch kein Nachteil.
Ist das das Bild von der Numismatik, das wir vermitteln wollen?
Das Problem, das ich dabei sehe, ist die Tatsache, dass wir in den Medien so tun, als könne es sich die Mehrheit der Sammler leisten, um eine 1,9 Mio. Franken teure Münze zu konkurrieren. Wir wissen, dass das nicht so ist. Unsere Umwelt sieht das anders.
Mit dem jüngsten Beispiel für diesen Irrglauben, hat mich ausgerechnet ein so genannter „Fachmann“ versorgt. Ein Redakteur des sonst so soliden Schweizer SRF fragte den österreichischen Edelsteinhändler Thomas Schröck, was denn die Diebe mit den Preziosen machen könnten, die sie im Louvre gestohlen haben. Wie aus der Pistole geschossen, kam die Antwort, dass das wohl ein Auftragsdiebstahl gewesen sei. Da könnte nur ein reicher Sammler dahinter stecken. Wie groß der Markt für solche historischen Schmuckstücke sei, fragt der Redakteur. Der „Fachmann“ antwortet: „Der Markt ist nur so groß, wie es eigenartige Menschen gibt, die so etwas gerne im Nachtkästchen oder im Tresor liegen haben.“
Okay, jetzt wissen wir es, Sammler sind eigenartige Menschen, die ihren Sammelobjekten gerne einen Gutenachtkuss geben, ehe sie sich friedlich zur Ruhe betten. Und dann träumen sie davon, welche Museen sie noch ausrauben lassen können.
Dass ein in seinem Bereich durchaus renommierter Autor es wagen kann, so einen Quatsch zu verzapfen, und dass sich ein renommiertes Medium auch noch bereit findet, diesen Unsinn zu publizieren, liegt daran, dass Schröck ein Bild aufgreift, das die Öffentlichkeit aus vielen Filmen kennt.
Medienberichte wie die über eine Münze für 1,9 Mio. Franken unterstützen diese Wahrnehmung. Die Tagesmedien berichten eben nur über Sammler, die in der Lage sind, Irrwitzsummen auszugeben. Und die kollektive Phantasie unterstellt einem Mann, der 1,9 Mio. Franken für eine Münze ausgibt, dass er auch zu illegalen Mitteln greifen würde, um sich diese Münze zu sichern.
Kulturgüter haben einen Materialwert
Dass die Tatsachen eine ganz andere Sprache sprechen, geht unter im Rauschen des Medienwalds. So hat sich die Hypothese, dass es der böse Sammler war, der ein paar unschuldige Diebe zum Raub im Louvre verführte, längst erledigt. Keine Überraschung! Wer die Berichterstattung über Diebstähle von Kulturgut verfolgt, weiß, dass das Muster ein anderes ist. Gestohlen werden Objekte mit hohem Materialwert, die leicht zugänglich sind und risikofrei in ihre Bestandteile zerlegt werden können. Eingeschmolzenem Gold sieht man es eben nicht an, ob es vorher eine Krone war oder sich im Zahn eines Verstorbenen befand. Das gleiche gilt für Juwelen. Allerdings muss man die besonders großen ein bisschen zerkleinern. Kann man. Tut man. Wäre ja sonst auch zu auffällig.
Moderne Ganoven gehen nach diesem Muster vor. Die einen brechen in den Louvre oder das Bode-Museum ein, die anderen in die Vitrine eines Regionalmuseums in Langres oder Manching. Wieder andere spezialisieren sich auf Kelche und Patenen aus Kirchen, die genauso mangelhaft geschützt sind wie die Goldmünzen in vielen Museen. Ach ja, Münzen werden natürlich besonders gerne geklaut. Nichts lässt sich leichter einschmelzen.
Die Strafen, die diese Übeltäter erwarten, sind – zumindest in Deutschland – so, dass ein Dieb sie lieber in Kauf nimmt, als seine Beute herauszugeben. Zwischen 4 und 7 Jahren erhielten die Ganoven von Manching. Ihr Verteidiger forderte bis zuletzt einen Freispruch aus Mangel an Beweisen. Und das, obwohl ein Bandenmitglied bei der Verhaftung noch einen Goldklumpen in der Hosentasche hatte.
100 Dukaten von 1629: 40.000 Euro oder 1,9 Mio. CHF?
Und damit zum Wert des bei NAC versteigerten Stücks. Es hatte gestern in Sammlerhänden den Wert von 1,9 Mio. Franken. Würde ein Dieb es heute stehlen, würde er sich über fast 40.000 Euro Schmelzwert freuen. Für einen Durchschnittsbürger ist auch das ein nettes Sümmchen.
Wir dürfen uns sicher sein, dass der Käufer ausreichende Vorkehrungen treffen wird, damit seine Münze nicht im Schmelztiegel endet. Bei Museen bin ich mir da nicht immer so sicher. Ich spreche jetzt noch gar nicht von Naivität, Faulheit oder Gewohnheit, sondern vom chronischen Geldmangel. Dass ein Museum an der Sicherheit spart, fällt nämlich nicht ins Auge. Oder sagen wir, es fällt erst dann ins Auge, wenn es zu spät ist. Dazu kommt, dass Verbrecherbanden heute mit einer derart brutalen Gewalt vorgehen, dass es sich ein normaler Museumskurator gar nicht vorstellen kann.
Alles Gold aus den Vitrinen räumen?
Die einfachste Lösung, einen Raub zu verhindern, wäre es natürlich, alle Goldmünzen aus den Vitrinen zu räumen. Im Kulturgüterschutzraum liegen sie vor frechen Dieben geschützt. Man kann ja ein paar Bilder ins Internet stellen.
Mit Nashornhörnern hat man das übrigens gemacht. Weil sie ein beliebtes Ziel von Diebesbanden waren, ersetzten Naturkundemuseen die echten Hörner durch Plastik. Kein Problem. Schließlich kamen die Besucher wegen des Nashorns, nicht wegen des Nashornhorns.
Bei Goldmünzen ist das schwieriger. Gerade sie üben die größte Faszination auf eine breite Öffentlichkeit aus. Wahrscheinlich weil der Wert des Goldes einfach leichter zu verstehen ist als die historische Botschaft einer Münze. Praktisch heißt das, dass unsere Ausstellungen an Anziehungskraft verlieren, wenn wir die Goldmünzen weglassen.
Es ist also ein kuratorischer Balanceakt zu entscheiden, wie viele und welche Goldmünzen in wie gesicherte Vitrinen gelegt werden. Ganz aufs Gold verzichten, sollte man in meinen Augen nicht. Die Tendenz geht zwar zum Objektfreien Museum, aber die Faszination des Originals ist ungebrochen.
Ein sinnvolles Leben ganz ohne Risiko ist eben auch für Museen nicht möglich. Es hat immer Diebstähle gegeben – übrigens häufig aus dem Kulturgutschutzraum. Und so richtig bekannt werden Objekte oft erst durch einen Diebstahl. Oder hatten Sie vorher schon vom Keltenschatz und Manching gehört?